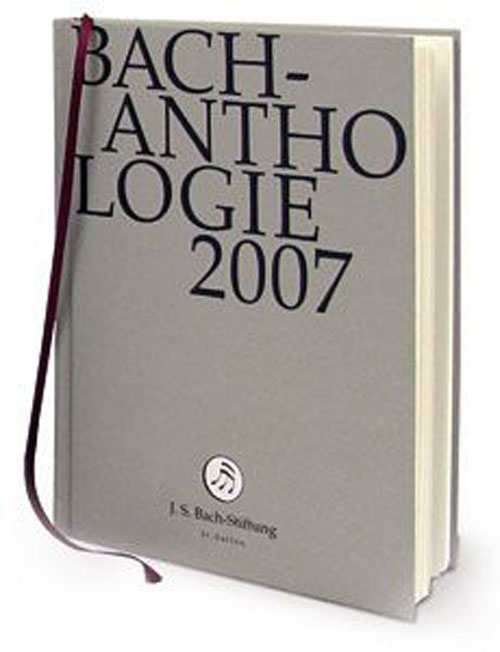Alles nur nach Gottes Willen
BWV 072 // zum 3. Sonntag nach Epiphanias
für Sopran, Alt und Bass, Vokalensemble, Oboe I+II, Streicher und Basso continuo
Die Lesetexte des 3. Sonntags nach Epiphanias legten in Bachs Zeit grösstmöglichen Nachdruck auf die Ergebung in Gottes Willen als Voraussetzung allen Heils. Entsprechend erhebt die noch von Bachs Weimarer Hofkollegen Salomo Franck gedichtete, jedoch erst 1726 in Leipzig vertonte Kantate BWV 72 diesen Gedanken zur entschlossen bejahten Lebensdevise. Gleich der drangvoll bewegte Eingangschor schärft sie mit in der Höhe gesteigerten Viertelschlägen und eifernden Chorkoloraturen unabweisbar ein, wobei einschliesslich einer ariosen Rezitativlitanei mehr als ein Dutzend Mal vom göttlichen Willen geredet wird. Dass sich mit der zunehmenden Hinwendung des Librettos zu Jesus als gütigem Heiland auch der klingende Tonfall kräftigt und entspannt, macht die Kantate zum sprechenden Exempel Bach‘scher Musiktheologie.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Chor
Sopran
Simone Schwark, Susanne Seitter, Noëmi Tran-Rediger, Alexa Vogel, Anna Walker, Mirjam Wernli
Alt
Roland Faust, Francisca Näf, Lea Pfister-Scherer, Lisa Weiss, Sarah Widmer
Tenor
Clemens Flämig, Zacharie Fogal, Tobias Mäthger, Klemens Mölkner
Bass
Fabrice Hayoz, Grégoire May, Simón Millán, Philippe Rayot, Tobias Wicky
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Eva Borhi, Lenka Torgersen, Peter Barczi, Christine Baumann, Petra Melicharek, Dorothee Mühleisen, Ildiko Sajgo
Viola
Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sarah Mühlethaler
Violoncello
Maya Amrein, Daniel Rosin
Violone
Markus Bernhard
Oboe
Andreas Helm, Ingo Müller
Fagott
Gilat Rotkop
Cembalo
Jörg-Andreas Bötticher
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Referent
Roman Bucheli
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
14.02.2020
Aufnahmeort
Trogen (AR) // Evangelische Kirche
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen (Schweiz)
Textdichter
Erstmalige Aufführung
27. Januar 1726, Leipzig
Textdichter
Salomo Franck (Nr. 1 – 5),
Herzog Albrecht von Preussen (Nr. 6)
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
«Alles nur nach Gottes Willen» entstand zum 3. Sonntag nach Trinitatis 1726 und ist damit Teil dieser stilistisch zunehmend vielgestaltigen Jahrgangsproduktion. Ihr Eingangschor bildet dabei einen Vertonungstypus aus, der einiges mit der Schwesterkomposition «Was mein Gott will» BWV 111 aus dem Vorjahr 1725 gemeinsam hat. Vor allem meint dies die sprechende Zweitongeste «Alles», die sich in unserer Kantate in mehreren staccato auszuführenden aufeinanderfolgenden Vierteltonsprüngen ausdrückt, die dann unmittelbar durch eine kleinteilige Sechzehntelkoloratur kontrapunktiert werden, so dass neben der energischen Einschärfung auch die tätige Wirksamkeit dieser Devise greifbar wird. Dass Bach diese eindringliche Komposition dann in den 1730er-Jahren zum Gloria seiner Missa in g-Moll BWV 235 umformte, verrät eine Menge sowohl über sein Qualitätsverständnis wie auch über seine transformatorische Phantasie.
Das folgende Altrezitativ führt den vom Eingangssatz ausgedrückten allgemeinen Anspruch konkret und detailreich aus, wobei die arios gestaltete Devise «Herr, so du willt» wiederum die gleichnamige Arie aus Bachs 1724 zum gleichen Sonntag im Kirchenjahr aufgeführter Komposition BWV 73 in Erinnerung ruft. Allerdings behalten in unserer Kantate von Aufbruch und Heilung redende optimistische Gedanken gegenüber der im Schwesterwerk noch dominierenden Sterbebereitung die Oberhand.
Entsprechend daseinsorientiert legt Bach auch die folgende Arie an, die sich aus einer bekenntnishaften Feststellung der Altstimme herausentwickelt, die dann ein virtuoses Duettieren zweier Violinen freisetzt: «Mit allem, was ich hab und bin, will ich mich Jesu lassen.» Neben der stets präsenten Dimension der Anfechtung wird hier auch die immense Inspiration hörbar, die ein konsequentes Agieren im Geiste Jesu in sich trägt – die vom Libretto aufgerufenen «Dornen und Rosen» gehören insofern untrennbar zusammen.
Wie solch erfahrungsgesättigtes Vertrauen klingen könnte, wird im folgenden Bassrezitativ greifbar, das sich in Jesu gewichtigem Versprechen «Ich will‘s tun» verdichtet. Davon inspiriert, kann die zugleich tänzerisch beschwingte wie sanft strömende Sopranarie «Mein Jesus will es tun» diesen Gedanken des hoffenden Glaubens in bezaubernde Klanggesten verwandeln. Die teilobligat geführte Oboe vermag es dabei, dem musikantischen Menuettsatz atmende Länge und zarte Verbindlichkeit einzuhauchen. Dabei spielt Bach dank einer geschickt eingeführten Fermate mit der zugleich entschleunigenden wie jenseitsbezogenen Bedeutung des Schlüsselwortes «ruhn», ehe der ohne ausgearbeitetes Nachspiel ungewöhnlich gestische Satzschluss die gegenwartsbezogene Präsenz der Zusage unterstreicht: Dieser Heiland will nicht nur allgemein das «Kreuz» der auf ihn Trauenden «versüssen», er wird es auch wirklich und genau jetzt für jeden Einzelnen von ihnen tun. Dass darauf dann quasi attacca der in allen Stimmen fliessende Schlusschoral «Was mein Gott will, das gscheh allzeit» als Manifestation der versammelten Gläubigen einsetzt, gehört zur trostspendenden Wirkung dieser Kantate unbedingt dazu.
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Chor
Alles nur nach Gottes Willen,
so bei Lust als Traurigkeit,
so bei gut als böser Zeit.
Gottes Wille soll mich stillen
bei Gewölk und Sonnenschein.
Alles nur nach Gottes Willen,
dies soll meine Losung sein.
1. Chor
Der Eingangschor zur Kantate BWV 72 war vom Weimarer Dichter Salomo Franck ursprünglich als Arie gedacht. Sie fasst die Bitte des Aussätzigen aus dem Sonntagsevangelium Matthäus 8, 1–13 «Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen» und Jesu Antwort «Ich will‘s tun» zusammen zu dem, was der Kantate Thema und Titel gibt: «Alles nur nach Gottes Willen». In seinem Orchestervorspiel arbeitet Bach in für ihn typischer Weise mit einem Gegensatzpaar aus abwärtsgerichteten StaccatoViertelschlägen (zu nächst Oboen plus Viola und später Singstimmen) sowie hektischen Sechzehntelläufen (Violinen I/II) – ein dankbares Material, das im Laufe des Satzes in allen denkbaren Kombinationen verwendet wird. Auf den Text «Gottes Wille soll mich stillen» lockert sich der Satzgestus in arioser Weise auf, ehe die ra sante Maschinerie des Beginns wieder ans Werk geht. Bach hat diese Vorlage mit ihrer mehr gestisch überzeugenden als im engeren Sinne wortausdeutenden Faktur offenbar so gut gefallen, dass er sie in den späten 1730er Jahren für das MollGloria seiner Missa brevis in g (BWV 235) heranzog.
2. Rezitativ / Arioso — Alt
O selger Christ,
der allzeit seinen Willen
in Gottes Willen senkt,
es gehe, wie es gehe,
bei Wohl und Wehe!
Herr, so du willt, so muß sich alles fügen!
Herr, so du willt, so kannst du mich vergnügen!
Herr, so du willt, verschwindet meine Pein!
Herr, so du willt, werd ich gesund und rein!
Herr, so du willt, wird Traurigkeit zur Freude!
Herr, so du willt, find ich auf Dornen Weide!
Herr, so du willt, werd ich einst selig sein!
Herr, so du willt, laß mich dies Wort im Glauben fassen
und meine Seele stillen!
Herr, so du willt, so sterb ich nicht,
ob Leib und Leben mich verlassen,
wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht!
2. Rezitativ / Arioso — Alt
Das Rezitativ führt aus, was Ergebung in Gottes Willen genauerhin heisst, und entfaltet dies in einem neunfach variierten Bittgebet: «Herr, so du willt», da müsse sich alles fügen, Traurigkeit zur Freude, Dornen zur Weide werden etc., ja Sterben in Leben sich ver wandeln, «wenn mir dein Geist dies Wort ins Herze spricht!». Entsprechend der latenten Dreiteiligkeit der Textvorlage rahmen zwei rezitativisch deklamierende Rahmenpassagen einen ariosen Mittelteil, der nach Art einer Litanei immer neue Bestimmun gen der kreisenden Devise «Herr, so du willt» aneinanderreiht und von daher als Schwesterkomposition der Bassarie der Kantate BWV 73 gelten kann.
3. Arie — Alt
Mit allem, was ich hab und bin,
will ich mich Jesu lassen,
kann gleich mein schwacher Geist und Sinn
des Höchsten Rat nicht fassen.
Er führe mich nur immerhin
auf Dorn und Rosenstraßen.
3. Arie — Alt
Die Altarie bekräftigt persönlich den Willen, «mit allem, was ich hab und bin» sich Jesu zu überlassen; auch dann, wenn man den Willen Gottes («des Höchsten Rat») nicht zu verstehen vermag – «er führe mich nur immerhin» auf Dornenwege des Leides oder Rosenstrassen der Freude. Die quasi attacca aus dem Rezitativ heraus anhebende Arie enthüllt ihre volle Besetzung mit zwei emsig konzertierenden Violinen sowie ihre musikalisch dunkle Reichhaltigkeit erst nach und nach.
4. Rezitativ — Bass
So glaube nun!
Dein Heiland saget: Ich wills tun!
Er pflegt die Gnadenhand
noch willigst auszustrecken,
wenn Kreuz und Leiden dich erschrecken.
Er kennet deine Not, und löst dein Kreuzesband!
Er stärkt, was schwach,
und will das niedre Dach
der armen Herzen nicht verschmähen,
darunter gnädig einzugehen.
4. Rezitativ — Bass
Das Bassrezitativ versteht das Jesuswort «Ich wills tun!» nun explizit als Aufforderung an alle, ihm Glauben zu schenken, und entwickelt seelsorgerlichen Zuspruch mit dem Hinweis, dass Jesus seine «Gnadenhand» ausstrecke, dies auf eine für heutiges Denken und Empfinden anspruchsvolle Weise. Die sonore Basslage und tröstliche Deklamation wirken nach den angespannten Arienkoloraturen besonders wohltuend.
5. Arie — Sopran
Mein Jesus will es tun, er will dein Kreuz versüßen.
Obgleich dein Herze liegt in viel Bekümmernissen,
soll es doch sanft und still in seinen Armen ruhn,
wenn es der Glaube faßt; mein Jesus will es tun.
5. Arie — Sopran
Die Arie verstärkt diese Überzeugung mit einer Figur aus der Leidensmystik, welche die eigenen Nöte und Ängste, das persönlich getragene Kreuz durch Jesu Zusage «versüsst» sieht und sich so Milderung verspricht. Entsprechend hellt sich mit der markanten DurTonalität, der erstmaligen Sopranlage, dem fliessenden Menuettduktus sowie der sanften Oboenfarbe die Klangwelt nunmehr auf. Trotz aller Kreuzestöne und verzagenden Momente behält die Singstimme das ganze Stück über ihre von verhalte ner Zuversicht getragene Leichtfüssigkeit.
6. Choral
Was mein Gott will, das g’scheh allzeit,
sein Will, der ist der beste,
zu helfen den’ er ist bereit,
die an ihn glauben feste.
Er hilft aus Not, der fromme Gott,
und züchtiget mit Maßen.
Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut,
den will er nicht verlassen.
6. Choral
Die Kantate endet mit dem von Albrecht von Brandenburg Ansbach, dem HohenzollernSpross, letzten DeutschordensHochmeister und schliesslich Herzog von Preussen, gedichteten Choral «Was mein Gott will, das g’scheh allzeit» (1547/1554). Dieser schliesst mit Worten einer religiösen Zuversicht: «Wer Gott vertraut, fest auf ihn baut, den will er nicht verlas sen.» Für kaum einen der Choräle des Reformations jahrhunderts passt das Attribut «kernig» so gut wie für dieses kämpferisch bekennende Trostlied, das Bach hier in einer zur ganzen Kantate passenden Weise vertont hat – äusserlich unprätentiös, aber meisterlich und mit leidgeprüfter Elegie in allem Vertrauen.
Die unsichtbare Hand Gottes
Roman Bucheli
Alles nur nach Gottes Willen. Was hatte sich Bach bloss gedacht, als er seine hinreissende Musik zu diesem ersten Vers der Kantate schrieb? Vielleicht, sehr verehrte Damen und Herren, vielleicht ging es Ihnen wie mir und Sie ertappten sich auch bei dem Gedanken: Die Botschaft hör ich wohl, allein, weiss ich denn, was das heisst: Alles nur nach Gottes Willen? Oder anders und ketzerisch gefragt: Wusste denn Bach, was gemeint war, wusste man es zu Bachs Zeiten?
Erlauben Sie mir, dass ich ein wenig aushole. Und erschrecken Sie nicht, wenn ich nun sehr weit aushole. Ich beginne mit der Hand Gottes. Sie meinen, das liege nicht so weit ab von unserem Weg? Schauen Sie selber!
Hätte es an der Fussball-Weltmeisterschaft 1986 in Mexiko bereits den Videobeweis gegeben, das legendäre Tor, das Diego Maradona mit der Hand erzielt hatte, wäre nie und nimmer anerkannt worden, Argentinien hätte gegen England vielleicht nicht gewonnen, die Mannschaft wäre nicht in den Final eingezogen und Maradona auch nicht Weltmeister geworden. Und glauben Sie mir, das alles müsste uns nicht weiter bekümmern. Aber wäre der Schiedsrichter dem schlitzohrigen Fussballgenie nicht auf den Leim gekrochen, es würde uns heute ein Satz fehlen, mit dem Maradona Ideengeschichte geschrieben hat. Er hat die Metaphysik um ihr schönstes Postskriptum erweitert. Nach dem Spiel zur Rede gestellt, wollte Maradona nicht vollends verleugnen, dass er geschummelt habe, aber höchstens ein wenig. Auf die inquisitorischen Fragen, ob es denn tatsächlich der Kopf oder nicht vielmehr seine Hand gewesen sei, die den Ball ins Tor gelenkt habe, antwortete er mit diesem grandiosen Satz: «Es war ein bisschen Maradonas Kopf und ein bisschen die Hand Gottes.» (Oder im Originalton: «Un poco con la cabeza de Maradona y otro poco con la mano de Dios.») Mit anderen Worten: Es war eine Kooperation von menschlichem Genius und göttlicher Manufaktur. Nicht ihre Unverfrorenheit machte aus Maradonas Antwort ein Bonmot für die Geschichtsbücher. Vielmehr liegt die Pointe in der grundstürzenden Umkehrung der Verhältnisse zwischen Gott und Mensch. Galt der Mensch bis dahin als ein Werkzeug Gottes, so ist es hier gerade umgekehrt. Gottes Hand kommt dort zu Hilfe, wo Maradonas Kopf sie haben will, weil er selber gerade nicht mehr herankommt. Gott assistiert mit einer Handreichung dem Genius Mensch: So sieht die Arbeitsteilung in der säkularisierten Welt aus. Wer, um Gottes willen, redet noch von Gottes Willen? Es zählt allein, was der Kopf, der Genius oder – in seiner emblematisch modernen Form – das in Grossbuchstaben geschriebene ICH will.
Was also hatte sich Bach gedacht, als er die Kantate schrieb, und was hatten sich die Leute denken müssen, als sie im Januar 1726 am dritten Sonntag nach Epiphanias in Leipzig die Kantate Alles nur nach Gottes Willen hörten?
Wollten wir boshaft sein, so könnten wir mutmassen, die Menschen hätten damals Gottes Willen in allem erkannt, was der Fall und damit ihr Verhängnis, weil unabänderlich, war. Dazu gehörte, dass in jenem Jahr 1726 in Frankreich der 16-jährige Louis XV seine Regentschaft antrat, um danach die absolutistische Herrschaft für viele Jahrzehnte auszuüben. Unumstösslich war auch die Tatsache, dass im gleichen Jahr Herzog August I., genannt der Starke (wenn das kein ICH in Grossbuchstaben war!), seit über dreissig Jahren auf dem Thron sass und sich mit aller barocken Pracht, die er aufbringen konnte, als Fürst und Herrscher über Sachsen (und also auch Leipzig) nach dem Vorbild des französischen Sonnenkönigs inszenierte. Da es ihm an ebenbürtigen Zeichen der Macht gebrach, hielt er sich mit umso pompöseren Adelstiteln schadlos, die ihn auch gleich in die Unmittelbarkeit zu Gott rückten. Das ging ungefähr so (und es hätte die Leute schon damals zum Lachen gebracht, wenn sie ein solches Gelächter nicht leicht den Kopf hätte kosten können): «Von Gottes Gnaden König in Polen, Grossfürst in Litthauen, Reussen, Preussen, Masovien, Samogitien, Kyovien, Volhynien, Podolien, Podlachien, Lieffland, erblicher Herzog zu Sachsen, Jülich, Cleve, Berg, Engern und Westphalen, des Heiligen Römischen Reichs Erzmarschall und Churfürst, Landgraf in Thüringen, Markgraf zu Meissen, auch Ober- und Unterlausitz, Burggraf zu Magdeburg etc. pp.»
Erkannten die Menschen vielleicht Gottes Willen gerade darin, dass er die Gnade hatte, sie zu Untertanen eines theatralischen Regenten zu machen, der ihnen mit verschwenderischem Überschwang manches Ungemach zumutete? Denn mit der Ausbreitung des Absolutismus ging in Sachsen zugleich eine Verarmung der Unterschicht einher. In Leipzig hatte dies zur Folge, dass sich Elendssiedlungen vor der Stadt ausbreiteten. Woran sonst, wenn nicht an den durchaus zweifelhaften Wohltaten ihres Fürsten, hätten die Menschen Gottes Willen erkennen sollen?
Doch gemach, «Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch». Als in Leipzig Bachs Kantate erklang und die Gläubigen dazu anhielt, sich dem Schicksal vielleicht nicht blindlings, aber doch voller Gottvertrauen zu ergeben, feierte in Königsberg ein gewisser Immanuel Kant schon bald seinen zweiten Geburtstag. Es sollte nur gerade noch knapp sechzig Jahre dauern, bis 1785 seine Grundlegung zur Metaphysik der Sitten erscheinen würde.
Das Ich als autonomes Subjekt, das sich seines Verstandes zu bedienen wusste und wagte, war gewiss keine Erfindung Kants. Sie fand ja gerade in Bachs Wohltemperiertem Klavier, wo die rationale über die natürliche Ordnung obsiegte, ihren kongenialen künstlerischen Ausdruck. Indessen hat keiner den Zeitgenossen mit grösserer Ernsthaftigkeit und mit ebenso gestochen scharfen wie bisweilen fast unverständlichen Sätzen ins Stammbuch geschrieben, es müsse nun ein Ende haben mit der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Kant brachte das Kunststück zustande, nicht etwa nur platt zu behaupten, der Mensch verfüge über einen freien Willen, nein, Kant ging weiter, indem er darlegte, der freie Wille sei gerade als solcher ein Ausweis der Sittlichkeit. Ein freier Wille und ein Wille unter moralischen Gesetzen seien nämlich einerlei.
Doch nun könnten wir wiederum etwas maliziös fragen: Wenn es den Menschen schon Schwierigkeiten bereitet hatte, den Willen Gottes als solchen zu erkennen, wie sollten sie nun wissen, wo die Triebhaftigkeit und damit die Unsittlichkeit aufhöre und wo der freie Wille und damit seine Sittlichkeit beginne? Das schwierige Geschenk dieser Freiheit schien die Menschen jedenfalls in eine Obdachlosigkeit zu verstossen, die sie vielleicht noch schlechter ertrugen als die Knechtschaft der Unfreiheit. So könnte es also ein böser historischer Treppenwitz sein, wenn am Ende des Jahres 1804, im gleichen Jahr also, da Kant starb, die französische Monarchie zwar längst weggefegt worden war, aber Napoleon sich nun in der Pariser Kathedrale Notre-Dame eigenhändig und nicht etwa von Gottes Gnaden – wenn auch im Beisein des Papstes – zum Kaiser der Franzosen krönte. Er nahm sich die Freiheit, seinen Untertanen die Freiheit zu nehmen. Die Geschichte wiederholte sich als Farce, das aufgeklärte, zu sich selbst befreite Subjekt aber durchlitt gerade seine bitterste Kränkung.
Freilich wird es an diesem historischen Wendepunkt erst richtig interessant. Denn zwischen dem entzauberten Himmel und dem wackligen Prekariat der neu gewonnenen Freiheit hat sich eine Lücke für ein Drittes geöffnet. Was Freud zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die halb revanchistische, halb triumphal klingende Sottise kleidete, das Ich sei noch nicht einmal Herr im eigenen Haus, gehörte längst zum Erfahrungsschatz der Dichter. Als Friedrich Hölderlin im September 1806 gegen seinen Willen – ja, auch das gibt es neben dem freien Willen oder neben Gottes Willen –, als Hölderlin gegen seinen Widerstand nach Tübingen in die Nervenheilanstalt verbracht und dort 230 Tage festgehalten worden war, kam er anschliessend in die Obhut des Tübinger Schreiners Erich Zimmer und verbrachte die letzten 36 Jahre und damit ziemlich genau die zweite Hälfte seines Lebens in dem dortigen Turmzimmer. Baten ihn Besucher gelegentlich um Gedichte, unterzeichnete er diese wahlweise mit Scardanelli, Buonarotti oder anderen Namen. Die Botschaft war so verworren wie im Grunde klar: Wo Hölderlin schreibt, schreibt immer auch noch ein anderer mit. Nun werden Sie mit gutem Grund einwenden, der arme Hölderlin sei ja nicht mehr ganz bei Trost gewesen damals. Mag sein. Aber bestürzender offenbarte sich die Lücke zwischen dem abwesenden Gott und dem schwächelnden Ich nie. Ungeachtet alles Pathologischen manifestierte sich darin die Lebensbedingung des aufgeklärten Ich, das nun immer auch seine Verletzlichkeit und Bedürftigkeit zu bedenken hatte. Das galt umso mehr für die künstlerische Existenz, die erst dort zu sich fand, wo sie jenseits der Verstandeskräfte andere, stillere Quellen erschliessen konnte.
Um in solche Sphären vorzudringen, empfahl der junge Arthur Rimbaud 1871 in seinen Lettres du voyant das freie Ausschweifen aller Sinne. Wer ein wahrer Dichter werden wolle, müsse sich dahin bringen, sagen zu können: «Es denkt mich.» Aber das klang Rimbaud zu sehr nach einem Kalauer. Er versuchte es präziser zu fassen und gelangte erst jetzt zu der schlichten Formulierung: «Ich ist ein anderer.» Von wegen freier Wille! Es schreibt immer ein anderer mit.
Wie war das also mit Maradona, und wie war das mit Bach? Kommen wir zurück auf die zu Beginn gestellte Frage, ob denn Bach dasselbe verstand wie sein Publikum, wenn er den Vers Alles nur nach Gottes Willen vertonte. Wir können einigermassen zuversichtlich sein hinsichtlich der Zuhörer, dass sie den Kantatentext im landläufig theologischen Sinne verstanden. Aber wie verhielt es sich mit Bach? Woran dachte er, als er die Noten setzte zu den Versen «O selger Christ, der allzeit seinen Willen / In Gottes Willen senkt»? Wusste Bach, was er tat? Senkte auch er als Komponist seinen Willen «allzeit» in Gottes Willen? Intuitiv würden wir behaupten: Er beharrte auf dem Eigensinn, dem freien Willen, auch wenn er es nicht so bezeichnet hätte, was er innerlich empfand. Aber schrieb trotzdem noch ein anderer mit, wenn er komponierte? Bach hätte nicht gesagt: «Ich ist ein anderer.» Aber wenn Bach seinen Kantatentext nur halbwegs ernst nahm, dann musste er doch im Innersten überzeugt sein, dass an seinen Kompositionen noch ein anderer mitwirke, der vielleicht nicht Scardanelli heisst und auch nicht Buonarotti. Hätte er ihn Gott genannt? Wer weiss. «Herr, so du willt…»: Nicht weniger als neunmal wiederholt der Kantatentext diese Formel. Klingt das nicht wie ein Stossseufzer des Komponisten, der verzweifelt gen Himmel schaut und auf Eingebung wartet?
Aber kann man sich Bach vorstellen, wie er innehält, wie er gar zweifelt, sich die Haare rauft, Blätter zerknüllt und in den Papierkorb wirft? Nicht wirklich. Man muss ja bloss einmal seine Partituren anschauen. Die schlichte Schönheit seiner Notenschrift stockt an keiner Stelle. Unbeirrt schreibt die Hand auf, was der Kopf mit dem Schriftbild vielleicht erst richtig zu hören beginnt. Kennen wir das? Kommt Ihnen das bekannt vor? Kennen wir diesen Kopf, dem die Hand vorauseilt? Kennen wir den Kopf, der weiss, wie der Ball getroffen werden müsste, aber nicht schnell genug heranfliegt, um die Fluglinie exakt zu kreuzen?
Hätte nicht auch Bach auf inquisitorische Fragen nach der zauberisch anmutenden Kunst seiner Werke antworten können: «Un poco con la cabeza de Bach y otro poco con la mano de Dios.» Nein, er hätte es nicht gesagt, denn Spanisch konnte er nicht. Er hätte es aber auch auf Deutsch nicht gesagt, denn es wäre ihm blasphemisch vorgekommen. Aber er hätte gewusst, was sein Freund, denn sicherlich wäre dieser Poet des Fussballs sein Freund gewesen, er hätte gewusst, was Maradona meinte: Ohne die Hand Gottes bleibt alle Poesie, ohne die Hand Gottes bleibt selbst der Fussball unvollendet.
Und Bach hätte auch gewusst, wovon wir hier reden. In seiner Hausbibel findet sich dieses Notat von seiner Hand: «Bey einer andächtig Musig ist allezeit Gott mit seiner Gnaden Gegenwart.» Maradona hätte es nicht anders in Hinsicht auf den Fussball gesagt. Ob Tonkunst oder Ballkunst, stets ist Gott darin gegenwärtig.
Gleichgültig, ob Bach es Gottes Gnade, ob Maradona es Gottes Hand nennt oder ob wir Heutige es noch einmal ganz anders heissen: die Kunst braucht das andere, sie braucht ihren Scardanelli, sie braucht immer auch noch die ganz andere Stimme aus dem Verborgenen, die nicht jene des ICH in Grossbuchstaben ist, um den Kairos des glücklichen Gelingens zu finden und ins Unabsehbare vorzustossen.