Wer weiß, wie nahe mir mein Ende
BWV 027 // zum 16. Sonntag nach Trinitatis
für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Horn, Oboe I + II, Streicher und Basso continuo
Bachs Kantaten zum 16. Sonntag nach Trinitatis sind entsprechend der Evangelienlesung (Luk. 7, 11-17) vom Gedanken der Todesnähe und Jenseitserwartung durchzogen. Bachs aus dem Jahr 1726 stammende Vertonung kombiniert in ihrem Eingangschor kommentierende Einschübe mit dem zeilenweisen Vortrag des von Ämilie-Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt gedichteten Liedes, das angesichts des schwerblütigen Passionsduktus des Orchesters fahle und tragische Züge ausbildet. Auch die mit Orgelsolo und Oboen da caccia exquisit instrumentierte Arie «Willkommen will ich sagen» sowie das mit dramatischen Bewegungskontrasten ausgestattete Basssolo «Gute Nacht, du Weltgetümmel» gewinnen dem Text höchst individuelle Lösungen ab. Selten in Bachs Musik wird das himmelsfreudige Loslassen so auf die Spitze getrieben wie im exaltierten «Flügel her!» des zentralen Sopranrezitativs. Anrührend wirkt das Bekenntnis zur älteren Thomanertradition, das Bach mit dem von Johann Rosenmüller (1652) übernommenen abschliessenden Choralsatz ablegte.
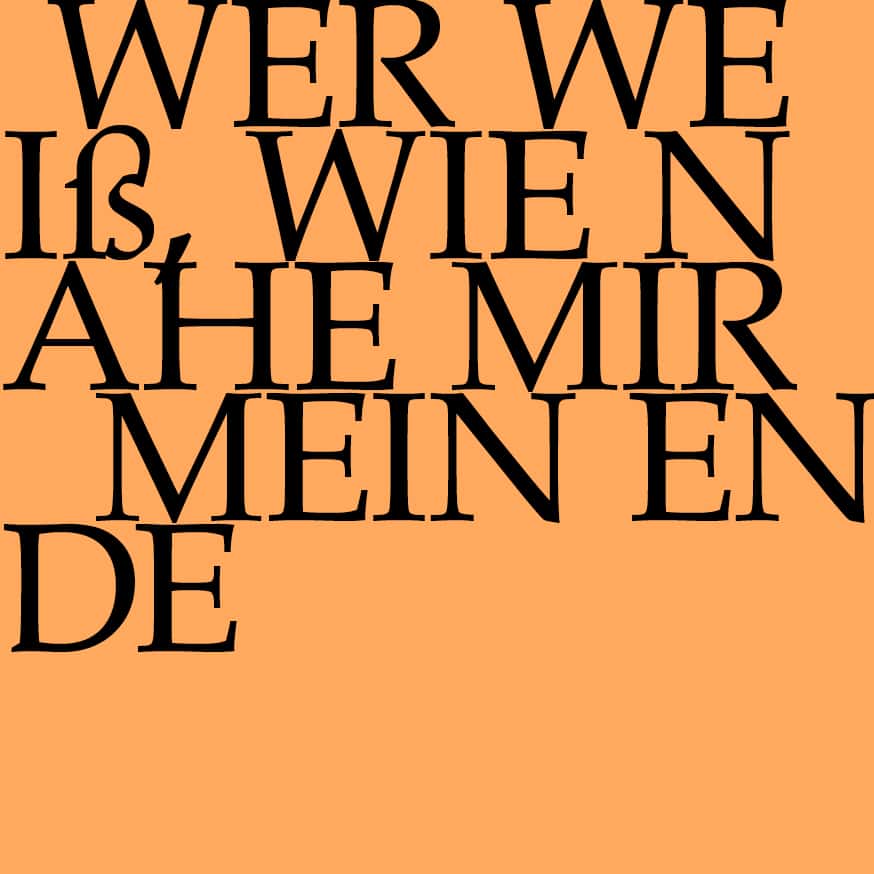
Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Bonusmaterial
Chor
Sopran
Lia Andres, Maria Deger, Jessica Jans, Simone Schwark, Noëmi Sohn, Alexa Vogel
Alt
Laura Binggeli, Antonia Frey, Lea Pfister-Scherer, Isabelle Stettler, Jan Thomer
Tenor
Zacharie Fogal, Joël Morand, Sören Richter, Walter Siegel
Bass
Jean-Christophe Groffe, Valentin Parli, Daniel Pérez, Retus Pfister, Philippe Rayot
Orchester
Leitung & Cembalo
Rudolf Lutz
Violine
Renate Steinmann, Monika Baer, Andrea Brunner, Elisabeth Kohler, Rahel Wittling, Salome Zimmermann
Viola
Susanna Hefti, Claire Foltzer, Stella Mahrenholz
Violoncello
Martin Zeller, Hristo Kouzmanov
Violone
Markus Bernhard
Horn
Thomas Friedländer
Oboe
Katharina Arfken, Laura Alvarado
Fagott
Susann Landert
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Referentin
Ina Schmidt
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
20.08.2021
Aufnahmeort
St. Gallen (Schweiz) // Olma-Halle 2.0
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Erstmalige Aufführung
6. Oktober 1726, Leipzig
Textdichter
Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (Satz 1); Unbekannt (Sätze 2–5); Johann Georg Albinus (Satz 6)
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
BWV 27 wurde zum 16. Sonntag 1726 nach Trinitatis komponiert und ist damit eine erst nach Abschluss des Jahrgangs 1724/25 komponierte Choralkantate Bachs. Während der Autor des Librettos bisher unbekannt ist, stammt das dem Eingangssatz zugrunde liegende Lied von der dem Reichsfürstenstand angehörenden Gräfin Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt (1637–1706).
Dieser Eingangschor erhält seine Prägung durch drei im Orchesterbeginn miteinander kombinierte Satzdimensionen. Ein in Oktavschritte aufgeteilter tiefer Grundton stellt das lastende Fundament bereit, zu dem fallende Oktavbrechungen in den Streichern sowie zwei empfindsam duettierende Oboen treten, die innerhalb des schwerblütigen Sarabandenduktus Seufzer und Dissonanzakzente aneinanderreihen und so einen heftigen Leidenston evozieren. Damit ist ein endzeitliches Bühnenbild bereitet, in das hinein der Chor seinen schlicht gehaltenen Choralvortrag einbringt, dessen grausige Prophezeiung eines «nahen Endes» durch rezitativische Einzelstimmeneinwürfe unterbrochen wird, die teils wirksam auf den Liedtext antworten («das weiß der liebe Gott allein») oder aber ihn subjektiv mahnend aneignen. Diese dramatische Wechselrede kontrastiert mit der depressiven Grundstimmung des Satzes und hebt somit sowohl die Dringlichkeit der Aussage als auch die Möglichkeit eines frommen menschlichen Handelns hervor, das durchaus noch zum demütigen Mitgestalter des eigenen Schicksals werden kann. In summa hat Bach hier eine veritable «Sankt-Mensch-Passion» geschaffen, die ohne vordergründigen Trost in düsterem c-Moll schliesst.
Entsprechend fällt es dem nur von wenigen Continuotönen gestützten Tenor in seinem Rezitativ hörbar gar nicht leicht, allzeit «zum Grabe fertig und bereit» zu sein. Schliesst doch die löbliche Maxime «Ende gut macht alles gut» in sich den gewichtigen Vorsatz ein, beständig so zu handeln, als wäre der heutige Tag bereits der letzte und damit der ultimative Prüfstein einer gottgefälligen Lebensführung.
Da herausgehobene emotionale Zustände bei Bach häufig aussergewöhnliche Instrumentierungen nach sich ziehen, entspricht es der in der folgenden Arie geschilderten jenseitsorientierten Läuterung der Seele, dass Bach neben der dazu passenden Altstimme mit einer Oboe da caccia sowie einer obligaten Orgelpartie besondere Klangfarben aufgeboten hat, die sich in für sie typischer Weise artikulieren. Dies meint bei der Oboe eine auf die Singstimme vorausweisende sprechende Kantilene, während die bei der ersten Aufführung wohl noch vom Cembalo ausgeführte Orgelpartie mit weiträumigen Läufen und Brechungen glänzt. Damit ist das ganze Stück über die Dimensionen der Ruhe und unablässigen Bewegung simultan präsent – was zwischen freudiger Erwartung und resignativer Ergebung jenes weite Spektrum an Empfindungen wachruft, das der Gedanke an den eigenen Tod eben auslöst. Das demonstrativ verfrüht anhebende Dacapo der «Willkommens»-Devise lässt dabei jedoch seelsorgerisch korrekt die Entschlossenheit die Oberhand behalten.
Mit dem Sopranrezitativ «Ach, wer doch schon im Himmel wär» wechselt Bach nochmals die Szenerie und öffnet nach dem tapferen «Pfeifen im Walde» der vorangehenden Arie nunmehr das Dachfenster hin zum Horizont jener höheren Freiheit, wie sie stets aus definitiv gefassten Entschlüssen resultiert. Diese Vision unmittelbarer Verschmelzung mit dem vergöttlichten Lamm in der Seligkeit des Himmels steigert sich zum drängenden «Flügel her!», das sogar die feierliche Steife des begleitenden Streichersatzes aufzubrechen vermag.
Die Bassarie führt den Protagonisten zurück in die Kämpfe des Erdendaseins. Im beständigen Wechsel von Entrücktsein und Bodenständigkeit, die hier absteigenden Kreisfiguren versus kurzatmigen Sechzehntelrepetitionen entsprechen, wird die Conditio humana eines guten Christen umrissen, der in allem noch ganz hier und doch schon woanders ist. Dass Bach dabei motivisch und vom Bewegungsduktus her zwei Schlüsselstellen der Johannespassion streift («Bei der Welt ist gar kein Rat» sowie «Der Held aus Juda siegt mit Macht»), mag Zufall sein – es passt jedoch zum inneren Ringen dieses alles andere als abgeklärten Satzes.
Für den Schlusschoral hat Bach sich eine besondere Volte aufgehoben, die zugleich eine Reverenz vor dem Leipziger Gesangbucherbe wie vor der Tradition der Thomasschule darstellt. Greift er doch unter Verzicht auf eine eigene Lösung auf jene fünfstimmige Version zurück, die Johann Rosenmüller 1649 und 1652 für die Beerdigung zweier Töchter des Leipziger Archidiacons Abraham Teller geschrieben hatte. Dieses äusserlich schlichte Gelegenheitsstück muss so geschätzt gewesen sein, dass es 1682 in Gottfried Vopelius‘ «Neu-Leipziger Gesangbuch» einging und noch 1719 von Bachs Amtsvorgänger Kuhnau einem Kantatenchor zugrunde gelegt wurde. Und so wie sich Bach selbst bis in die beibehaltene mensurale Notation der abschliessenden Doppelzeile hinein vor der berückenden Schönheit seiner Vorlage verbeugte, haben auch wir diesen Satz mit eingefügten Wiederholungen und Consortspiel-Passagen gebührend zelebriert.
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Choral und Rezitativ — Sopran, Alt, Tenor
Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?
Sopran
Das weiß der liebe Gott allein,
ob meine Wallfahrt auf der Erden
kurz oder länger möge sein.
Hin geht die Zeit, her kömmt der Tod.
Alt
Und endlich kommt es doch so weit, daß sie zusammentreffen werden.
Ach, wie geschwinde und behende
kann kommen meine Todesnot!
Tenor
Wer weiß, ob heute nicht mein Mund die letzten Worte spricht! Drum bet ich alle Zeit:
Mein Gott, ich bitt durch Christi Blut,
machs nur mit meinem Ende gut!
1. Choral und Rezitativ
«Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?» So beginnt die erste Strophe eines Sterbeliedes von Ämilie Juliane von Schwarzburg-Rudolstadt, das vom Chor nach der bekannten Melodie «Wer nur den lieben Gott lässt walten» gesungen wird, ergänzt nach jeder Liedzeile durch kommentierende Einschübe des unbekannten Textdichters in der Sopran-, in der Alt- und schliesslich in der Tenorstimme. Der Evangelientext vom Tod und von der Auferweckung des Jünglings zu Nain (Luk. 7, 11–17) findet auf diese Weise seine Auslegung. Damit ist das Thema der Kantate umrissen: Todesfurcht und fromme Sterbebereitschaft. Dieser Kontrast spiegelt sich im Orchestersatz, der herabsinkende Oktavbrechungen der Streicher mit gramvoll gepressten Seufzern der Oboen und einer weitgehend statischen Continuostütze kombiniert. Im Kontrast zur argumentierenden Gewissensrede der Solopassagen wirken die zugleich schlicht wie meisterlich gesetzten Choralzeilen besonders eindrücklich.
2. Rezitativ — Tenor
Mein Leben hat kein ander Ziel,
als daß ich möge selig sterben
und meines Glaubens Anteil erben;
drum leb ich allezeit
zum Grabe fertig und bereit,
und was das Werk der Hände tut,
ist gleichsam, ob ich sicher wüsste,
daß ich noch heute sterben müsste;
denn: Ende gut, macht alles gut.
2. Rezitativ
Das Rezitativ verbindet nun Todesbereitschaft mit der gläubigen Gewissheit eines seligen Sterbens – «drum leb ich allezeit zum Grabe fertig und bereit» – und antwortet damit auf die letzte Zeile im ersten Satz: «denn: Ende gut macht alles gut.»
3. Arie — Alt
Willkommen! will ich sagen,
wenn der Tod ans Bette tritt.
Fröhlich will ich folgen,
wenn er ruft in die Gruft.
Alle meine Plagen
nehm ich mit.
3. Arie
Die Altarie verdeutlicht dies mit einem mutigen «Willkommen», wenn der Tod ans Bett trete, und verspricht, ihm zu folgen, denn dies werde alle Leiden (Plagen) beenden. Dass Bach dafür eine ganz besondere und gewissermassen bereits «jenseitige» Stimmung schaffen wollte, wird in der Faktur und Besetzung des Satzes unmittelbar deutlich, wobei er entweder noch im Probenprozess oder aber im Zuge einer späteren Aufführung vom Cembalo solo zur obligaten Orgel wechselte. Die warme Fülle der eine Quint unter Normallage spielenden Oboe da caccia, die flirrenden Figurationen des Tasteninstrumentes sowie die tapfere Deklamation der Altstimme verbinden sich zu einem ausserordentlich entrückten Seelenbild, dessen schiere Länge den unvermeidlichen Abschied zugleich in die Länge zu ziehen scheint.
4. Rezitativ — Sopran
Ach, wer doch schon im Himmel wär!
Ich habe Lust zu scheiden
und mit dem Lamm,
das aller Frommen Bräutigam,
mich in der Seligkeit zu weiden.
Flügel her!
Ach, wer doch schon im Himmel wär!
4. Rezitativ
Das Sopranrezitativ steigert die Jenseitssehnsucht und verbindet diese mit der mystischen Symbolik von Christus als Lamm und zugleich als Bräutigam der Seelen. Es schliesst mit dem frommen, aber auch barschen Satz «Flügel her! Ach, wer doch schon im Himmel wär!» Bach braucht nur acht beweglich ausinstrumentierte Takte, um den Übergang von schwärmerischer Jenseitserwartung zu entschlossener Weltabsage zu illustrieren.
5. Arie — Bass
Gute Nacht, du Weltgetümmel!
Jetzt mach ich mit dir Beschluß,
ich steh schon mit einem Fuß
bei dem lieben Gott im Himmel.
5. Arie
«Gute Nacht, du Weltgetümmel!», die Bassarie begründet die Abschiedsbereitschaft damit, dass man ja mit einem Fuss schon im Himmel stehe. In der Musik werden hingegen die Kämpfe und Konflikte weiterhin ausgetragen – der sarabandenhaft elegische «Gute Nacht»-Beginn wird bereits im Streichervorspiel und dann im gesamten Arienverlauf immer wieder mit einem hektisch repetierenden «Weltgetümmel» konfrontiert.
6. Choral
Welt, ade! Ich bin dein müde,
ich will nach dem Himmel zu,
da wird sein der rechte Friede
und die ewge stolze Ruh.
Welt, bei dir ist Krieg und Streit,
nichts denn lauter Eitelkeit,
in dem Himmel allezeit
Friede, Freud und Seligkeit.
6. Choral
Der Text des Schlusschorals zitiert integral die erste Strophe von Johann Georg Albinus’ Lied «Welt, ade! Ich bin dein müde». Mit ihr findet das Thema der Weltmüdigkeit, der Todesbereitschaft und der Himmelshoffnung dieser Kantate ihre Zusammenfassung. Der auch in das Leipziger Gesangbuch von Vopelius (1682) eingegangene arienartig aufgebrochene Choralsatz wurde von Johann Rosenmüller 1649 und 1652 als Begräbniskomposition für zwei Angehörige der Leipziger Pfarrerfamilie Teller geschrieben.
Ina Schmidt
«Wer weiß, wie nahe mir mein Ende?»
Als ich diese besondere Sterbekantate Johann Sebastian Bachs zum ersten Mal hörte, war ich überrascht von der lebendigen Kraft, die dieses Stück ausstrahlte – als wollte die Musik der Sorge um die eigene Endlichkeit etwas entgegensetzen, etwas, das es wagt, sich auf dieses Nichtwissen um die eigene Vergänglichkeit und Endlichkeit einzulassen.
Und dennoch meldete sich gleichzeitig eine Skepsis, eine prüfende und zweifelnde Distanziertheit gegenüber diesem mutigen Wagnis: Können wir der eigenen Endlichkeit überhaupt etwas entgegensetzen, ist allein der Gedanke nicht allein Hoffnung und Sehnen?
Oder können wir es nur heute nicht mehr? Liegt es daran, dass im 18. Jahrhundert noch ein anderer Umgang mit dem Tod und dem Sterben gepflegt werden konnte, der Nachklang der aus dem Mittelalter stammenden Ars moriendi – der Kunst des Sterbens? Eine solche Kunst sollte damals den Tod nicht aus dem Leben vertreiben, sondern dafür sorgen, dass wir uns auf ein Sterben vorbereiten können, das wir als gut annehmen können.
Lässt sich der Tod also auf diese besondere kunstvolle Art «zähmen»? Der französische Kulturhistoriker Philippe Aries war sicher, dass der Tod in früheren Epochen eben ein solcher «gezähmter» Tod gewesen sei, eingebettet in Zeremonien und Weltbilder, religiöse Überzeugungen und Vorstellungen, die aus Worten und Melodien, aus Gedanken und Poesie eine kulturelle Textur weben, in der Menschen sich einrichten können, die wir heute aber oftmals als neblige Illusionen, Narrative oder «Biases» abtun, aufgeklärt und säkularisiert, wie wir uns heute den Tod zu erklären versuchen.
Aber eben gerade dadurch, so Aries, halten wir uns die eigene Endlichkeit nicht vom Hals, aller medizinischer und technischer Fortschritt hat oft nur zur Folge, dass aus dem gezähmten ein verwilderter Tod wird – hinter zugezogenen Gardinen, einsam, allein mit blinkenden Geräten und Schläuchen, die das Leben gegen das Sterben verteidigen sollen. In all unserem Wissen und Erklären fehlt uns letztlich das, was sich auch in dem Text der Sterbekantate findet: Der Glaube an etwas, das uns eine andere Form von lebendiger Gewissheit geben kann, das Vertrauen in etwas, das grösser ist als wir selbst – und damit eine gelebte Gewohnheit mit einem Tod ermöglicht, der uns irgendwann bevorstehen wird, der seinen Schrecken nicht verliert, aber den wir ertragen können.
Schlussstücke
Umringt von all diesen Zweifeln und prüfenden Fragen erinnerte ich mich an das «Schlussstück» des Dichters Rainer Maria Rilke, Worte, die für mich schon lange von Bedeutung sind: «Der Tod ist gross, wir sind die Seinen lachenden Munds – wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen, mitten in uns.»
Vor über zwanzig Jahren waren diese Zeilen Teil einer Todesanzeige, mit der mein Mann und ich uns von einem guten Freund zu verabschieden versuchten. Er war plötzlich gestorben, an einem Infekt, vermeintlich nichts Ernstes ‒ mitten im Leben, gerade Vater geworden, im Begriff zu heiraten, sein Vater sagte auf der Beerdigung: «Wir waren gerade alle so glücklich.»
Ich erinnere mich daran, wie ich nach seinem Tod das erste Mal die eigentlich so vertraute Wohnung betrat, in der wir so oft gekocht, gefeiert und über all die wichtigen und unwichtigen Dinge des Lebens nachgedacht hatten. Seine Schuhe standen noch im Flur, alles schien wie immer, und doch lag eine Leere, eine Abwesenheit in diesen Räumen, die alles fremd erscheinen liess, alles viel grösser und mich so viel kleiner.
Im Angesicht des Todes trifft uns die Erkenntnis, dass der Tod nah ist und wir ihn doch nicht greifen können – dieses Wissen, dass diese Nähe nicht erst am Ende eines langen Lebens von Bedeutung sein muss, bricht sich plötzlich mit voller Kraft Bahn. Wir sind vergängliche Wesen, von dem Moment unserer Geburt geht es auf ein Ende zu, das wir nicht kennen können. Wir wissen um das «Das», aber nicht um das «Wann». Niemand kann wissen, «wie nahe mir mein Ende» ist oder wie oft ich schon in der Nähe des Todes gewesen sein mag. Des eigenen oder desjenigen eines anderen geliebten Menschen, mit dem wir doch gerade noch zusammengesessen haben: «Wer weiss, ob heute nicht mein Mund die letzten Worte spricht?»
Diese Unwissenheit ist ambivalent. Sie schützt uns, die Vorstellung einer Zukunft, in der der Tod noch fern ist, hilft, das Leben als kostbares Geschenk anzunehmen und mit Taten, Wünschen, Erfahrungen und Zielen zu füllen. Und doch müssen wir uns nicht selten gewahr werden: Mitten im Leben wagt der Tod in uns zu weinen. Dieses Erlebnis ist eindrücklich und schmerzhaft, aber es rüttelt auch wach, macht uns den Wert des Lebens auf andere Weise deutlich und wirft manchmal sogar «lachenden Munds» neue Fragen auf.
Aber wie können wir diese Spannung und Ungewissheit aushalten? Wie können wir Menschen lieben und Sinn stiften, wenn wir uns diesen Gedanken in aller Klarheit widmen? Sinnlos und absurd scheint ein Leben, das nichts anderes tut, als zu Ende zu gehen? Und doch sind wir Wesen voller Hoffnung auf ein gutes, gelingendes und langes Leben, in dem wir etwas schaffen, das bleiben könnte, auch wenn alles zu Ende geht.
Die Kunst, diese vermeintlichen Widersprüche in sich aufzunehmen und das Lachen und Weinen nebeneinander, vielleicht sogar gleichzeitig in sich anzunehmen, ist keine leichte Aufgabe, aber wir sind dazu in der Lage. Wir kommen als endliche Wesen auf die Welt, geboren in eine ungewisse Zukunft, und je näher wir diesem Anfang sind, desto selbstverständlicher scheint dieses Wissen zu sein: Wir sind nicht nur endlich, sondern auch «anfänglich», jedes Ende birgt einen Anfang, auch wenn wir ihn nicht kennen können. Sprechen wir mit Kindern über den Tod, dann dürften wir überrascht sein, wie weise und selbstverständlich der Umgang dieser kleinen Menschen und jungen Geister mit der Vergänglichkeit oftmals ist – sie sind viel weniger daran interessiert, zwischen Leben und Tod zu unterscheiden, sondern wissen um die Bedingtheit der beiden – auch wenn sie es nicht immer in Worte fassen können. Dass dabei Tränen fliessen, ist kein Grund, es nicht zu versuchen und – irgendwann scheint dann ja auch wieder die Sonne, wie ich von einer 12-jährigen Denkerin lernen durfte. Können wir lernen, den Tod in unser Leben zu lassen, oder vielmehr üben, ihn auf eine eigene und neue Weise zu zähmen?
Philosophieren heisst «sterben lernen».
Der Denker Michel de Montaigne hielt die Philosophie für die geistige Tätigkeit, die uns bei diesem Vorhaben helfen, also tatsächlich das Sterben lehren könnte. In seinem berühmten Essay «Philosophieren heisst sterben lernen» fragt der Philosoph: «Das Ziel unserer Laufbahn ist der Tod – auf ihn sind unweigerlich unsere Blicke gerichtet. Wie können wir, wenn er uns Angst und Schrecken einjagt, auch nur einen Schritt ohne Schaudern nach vorne tun?» Darauf kann es für Montaigne nur eine Antwort geben: Wir müssen versuchen, den Tod zu uns einzuladen und ihm dadurch seinen Schrecken zu nehmen – dies sei die einzige Möglichkeit, sich nicht in ein erlösendes Jenseits zu retten, sondern ein wahrhaft gutes Leben zu führen. Dabei aber meinte der Philosoph nicht die in der Kantate angedeutete Haltung, jederzeit zum Sterben bereit und in Erwartung des Todes zu leben, sondern das eigene Leben kraftvoll und gegenwärtig auszuschöpfen und dennoch zuzuhören, wenn der Tod hin und wieder in uns zu weinen beginnt. Ihn einzuladen, auch wenn es schmerzt und uns Angst macht, wie eine Art geistiges «Trotzdem»: «Berauben wir ihn seiner Unheimlichkeit, pflegen wir Umgang mit ihm, gewöhnen wir uns an ihn, bedenken wir nichts so oft wie ihn.»
Dieser Gedanke klingt nach etwas, das wir versuchen können. Aber nicht alle stimmen Montaigne darin zu: Der Philosoph Vladimir Jankélévitch beispielsweise ist in seinem Werk «Der Tod» fest davon überzeugt, dass wir uns «entschieden nicht an den Tod» gewöhnen können. Er trifft uns immer in aller Härte und bei aller Vorbereitung plötzlich. Die eigene Endlichkeit bleibe eine der grössten Kränkungen des Menschen, so Jankélévitch.
Auch ich bin sicher: Die meisten von uns haben Erfahrungen gemacht, in denen wir untröstlich waren und sicher nicht üben wollten, uns an den Tod zu gewöhnen. Aber ist er deshalb gleichbedeutend mit einer Kränkung? Kann eine Kränkung nicht nur aus einer enttäuschten Erwartung entstehen und wie genau kann eine Erwartung an das Leben aussehen? Was genau ist uns das Leben schuldig, wenn wir ihm seine eigene Vergänglichkeit übelnehmen dürfen? Ja, das Ende trifft uns immer unversehens, «unseren Vorsichtsmassnahmen zum Trotz», wie Jankélévitch betont, aber es geht in einem gelingenden Leben nicht darum, den Tod zu verhindern, sondern um die Möglichkeit, mit ihm zu leben – ohne auf immer daran zu verzweifeln. Es geht darum, Trost und Halt zu finden in etwas, das möglicherweise dadurch ein Versprechen sein kann, weil es über uns und das eigene Leben hinausgeht.
Leben im Angesicht des Todes
Und ist es nicht auch das, was Bach in seiner Musik versucht? Trost im Angesicht des Todes zu ermöglichen, nicht Worte wie Rilke oder Montaigne zu finden, sondern Musik als Sprache zu nutzen, um Halt und Formen des Ausdrucks zu schaffen, die ein «Trotzdem» denk- und spürbar sein lassen. Ein Trotzdem, das auch in der Fraglichkeit liegt, einer so radikalen Fraglichkeit, die wieder zu einer Möglichkeit werden kann. Ein Leben wird nicht wert- und sinnlos dadurch, dass es irgendwann zu Ende geht. Ganz im Gegenteil: Es lebt nur in diesem Spannungszustand von Kommen und Gehen, von Anfang und Ende und der Mensch ist wohl das einzige Wesen, das in der Lage ist, sich bewusst mit diesem Wissen zu beschäftigen: Nur wir führen ein Leben im Angesicht des Todes, wenn wir uns dafür entscheiden.
Am Ende all dieser Überlegungen mag dann tatsächlich der Wunsch stehen, wie es in der Kantate heisst, dass das eigene Ende ein «gutes» sein möge, denn «Ende gut macht alles gut».
Das Ende eines erfüllten Lebens, in dem wir nicht plötzlich aus der eigenen Mitte gerissen werden, sondern ein Leben, von dem wir Abschied nehmen können ‒ weltmüde und lebenssatt ‒, und dies vielleicht nicht mehr ertragen müssen, sondern sogar wollen können. Ich hoffe, sehr, dass auch unser Freund, der noch so gar nicht lebensmüde und weltsatt auf eine Zukunft gehofft hat, die erst noch gestaltet werden wollte, damals diese Ruhe finden konnte. Einen Frieden, der vielleicht kein irdischer sein kann und der für uns, die hier darüber nachdenken, nur als Frage und Möglichkeit lebendig ist. Eine Frage, die wir uns stellen können, gemeinsam mit Worten und in der Musik – aber dann sind wir schon auf dem Weg, genau das zu tun, was Montaigne sich so sehr gewünscht hat: Dem Tod seinen Schrecken zu nehmen, indem wir ihn zu uns einladen – in all dem Unwissen um das Ende, das uns irgendwann bevorstehen wird.



