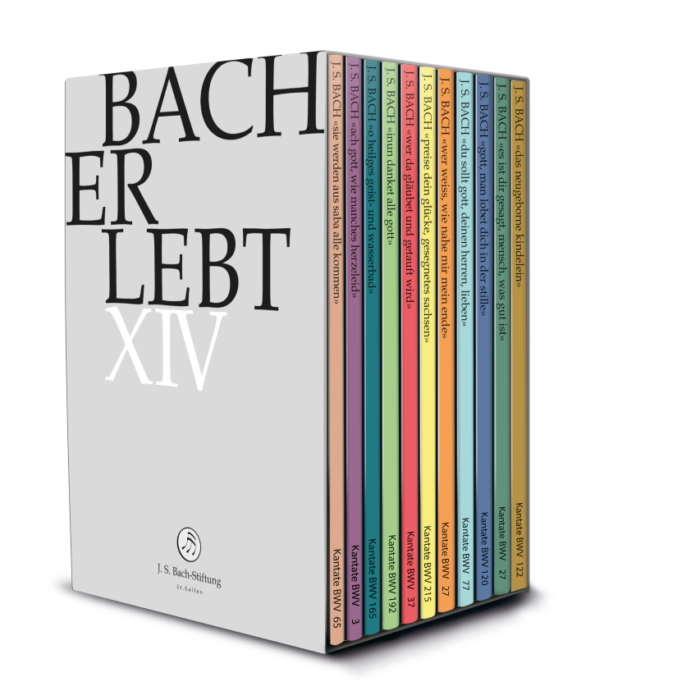Gott, man lobet dich in der Stille
BWV 120 // zur Ratswahl
für Sopran, Alt, Tenor und Bass, Vokalensemble, Trompete I–III, Pauke, Oboe I + II, Streicher und Basso continuo
Der alljährlich am Bartholomäustag (24. August) in der Leipziger Nikolaikirche zelebrierte Ratswechsel bildete den Höhepunkt der kommunalen Herrschaftsrepräsentation und bedeutete für Bach als städtischen Director musices eine ehrenvolle Zusatzaufgabe. Daher zeichnen sich seine Ratswechsel-Musiken durch hohe Qualität und grosse Besetzung aus; die aus einer langwierigen Entstehungsgeschichte hervorgegangene und bis in die 1740er-Jahre mehrfach wiederaufgeführte Kantate BWV 120 weicht davon nur insofern ab, als sie den Gegensatz von «Stille» und «Jauchzen» in die Folge einer verhalten pulsierenden Eröffnungsarie und eines nachgestellten Tutti-Chores übersetzte, den Bach später für das «Etexpecto» seiner h-Moll-Messe umfassend revidierte. Der bezaubernden Sopranarie «Heil und Segen» merkt man ihre zwischenzeitliche Umwidmung zu einer Hochzeitsmusik an; zudem hat Bach, der selbst ein herausragender Geiger war, sie auch als Sonatensatz für Violine und Cembalo hinterlassen.
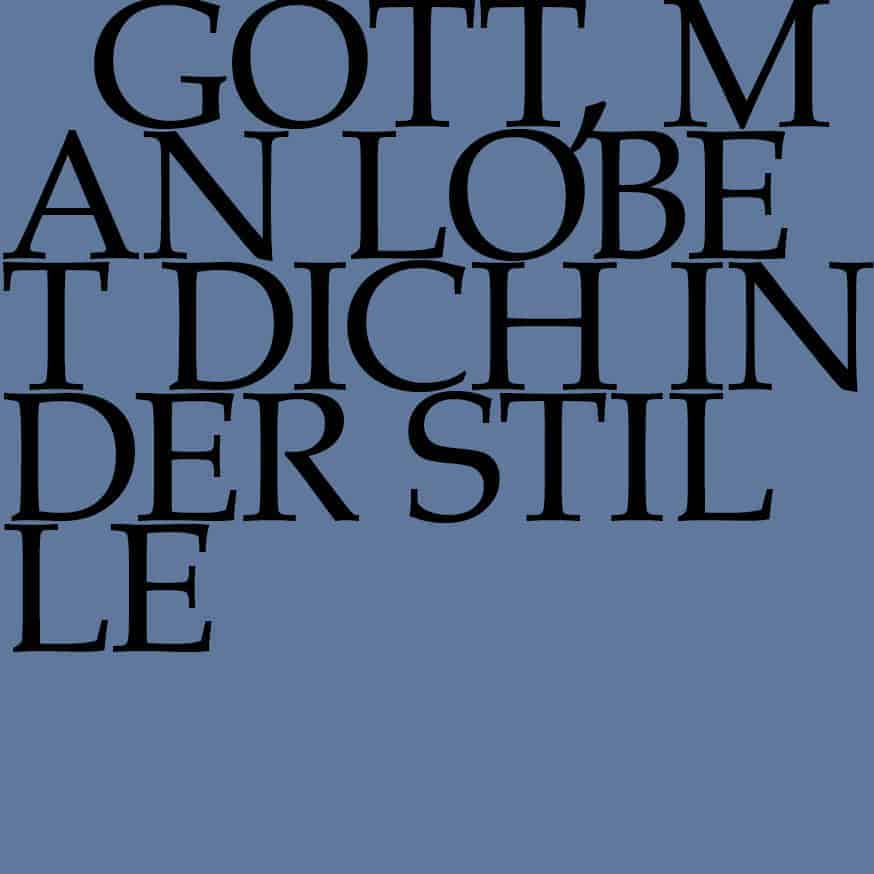
Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Bonusmaterial
Chor
Sopran
Alice Borciani, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Noëmi Tran-Rediger, Baiba Urka, Mirjam Wernli
Alt
Antonia Frey, Katharina Guglhör, Lea Pfister-Scherer, Simon Savoy, Lisa Weiss
Tenor
Clemens Flämig, Manuel Gerber, Christian Rathgeber, Sören Richter
Bass
Fabrice Hayoz, Serafin Heusser, Johannes Hill, Daniel Pérez, Tobias Wicky
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Renate Steinmann, Olivia Schenkel, Patricia Do, Elisabeth Kohler, Marita Seeger, Salome Zimmermann
Viola
Susanna Hefti, Claire Foltzer, Stella Mahrenholz
Violoncello
Martin Zeller, Hristo Kouzmanov
Violone
Markus Bernhard
Trompete
Lukasz Gothszalk, Bruno Fernandes, Alexander Samawicz
Pauke
Laurent de Ceuninck
Oboe
Linda Alijaj, Laura Alvarado
Fagott
Susann Landert
Cembalo
Thomas Leininger
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Referent
Hermann Hess
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
29.10.2021
Aufnahmeort
St. Gallen (Schweiz) // Olma-Halle 2.0
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Erste Aufführung
Erstfassung wohl 1729, spätere Fassung 1742 oder später – Leipzig
Textdichter
Psalm 65.2 (Satz 1); Unbekannt (Sätze 2–5), Martin Luther (Satz 6)
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
Das alte Leipzig war keine eigenständige Republik, sondern eine zum Kurfürstentum Sachsen zählende Stadt, über deren Geschicke und Leitungspersonal letztlich der Landesherr entschied. Dennoch gab man sich der Bedeutung der Messestadt entsprechend Mühe, diese Abhängigkeit durch symbolische Akte zu überh.hen und so den Anschein einer kommunalen Eigenverwaltung zu erwecken sowie eine möglichst grosse Zahl an Patriziergeschlechtern in die Stadtspitze einzubinden. Dazu gehörte der turnusmässige Wechsel dreier Ratskollegien, von deren zwei «ruhenden » jeweils eines zum «sitzenden», also auf dem Papier tatsächlich regierenden, erhoben wurde. Der entsprechende Weiheakt wurde alljährlich am Bartholomäustag in St. Nikolai, der Ratskirche der Stadt, begangen – die zugehörigen Figuralmusiken gehörten zu Bachs vornehmsten und extra honorierten Leipziger Dienstpflichten, weshalb die von seiner Hand erhaltenen fünf Ratswechselkantaten zu seinen klangprächtigsten Kompositionen gehören. Die aus einer langen verwickelten Entstehungsgeschichte mit verschiedenen anlassgebundenen Vorfassungen – etwa zu Trauungen und zum Jubiläum des Augsburger Religionsbekenntnisses 1730 – hervorgegangene Kantate BWV 120 wurde in der heute überlieferten Version nicht vor 1742 uraufgeführt.
Dem in leuchtendem A-Dur stehenden Eingangssatz ist dank der Besetzung mit Alt und zwei Oboen d’amore eine zart schwebende Aura eigen, die zur musikalisch sensibel umgesetzten «Stille» passt. Der für eine Festkantate überraschend verhaltene Beginn erweist sich so als tönende Deutung ihres in der Textkompilation aus Psalmwort und freier Ergänzung angelegten Steigerungseffektes. In den Koloraturen der Singstimme und der Oboen wird dabei eine Energie spürbar, die auf die folgende musikalische Eruption verweist. Mit dem Chor Nummer 2 klappt die musikalische Maschinerie ins trompetenglänzende D-Dur; im Wechsel von Fanfarenmotiven und Fortspinnungsfiguren wird dem «Jauchzen» der «erfreuten Stimmen» klangprächtig Raum gegeben. In dieses beschwingte Rondo sind fugierte Episoden eingestreut, die wie ein vom Boden aufsteigender Opferrauch stufenweise nach oben ziehen. Dass Bach diesen entfesselten Dankchor gegen Ende seines Lebens für das jenseitsgewisse «Et expecto resurrectionem mortuorum» seiner h-Moll-Messe bearbeitete, bezeugt seine grosse Wertschätzung der Vorlage. Den kompakter angelegten Mittelteil «Lobet Gott im Heiligtum» liess er dabei aus – einen Textabschnitt immerhin, der die Leipziger Nikolaikirche demonstrativ zum neuen Tempel einer als Gottesstadt Jerusalem aufgefassten Idealkommune hochstilisierte.
Diese Bezüge werden im Bassrezitativ weiter ausgeführt. Die von der Forschung sprachhistorisch verworfene, jedoch alteingeführte Lesart des Leipziger Stadtnamens als «Lindenstadt » findet dabei ebenso Erwähnung wie das reziproke Verhältnis von demütigem Dank und väterlichem Schutz sowie das Ratswahlprozedere selbst. In pathetischem Ton beschwört der Solist zugleich die kommunale Einheit wie die Hierarchie ihrer dies- und jenseitigen Regierung.
In etlichen der Bach’schen Ratskantaten folgt auf derlei staatsfundamentale Erinnerung eine persönliche Aneignung, die die Segnungen des erneuerten Bundes als Grund allgemeinen Wohlbehagens erlebbar macht. Kaum ein Stück leistet dies in so berührender Weise wie die im schwebenden 6⁄8-Takt stehende Sopranarie «Heil und Segen», mit der Bach passenderweise auf ein musikalisches Material zurückgriff, das er bereits zum Lobpreis ehelicher Verbindung herangezogen hatte («Leit, o Gott, durch deine Liebe» BWV 120a/3). Da dieser Satz mit seiner funkelnden Violino- Concertino-Stimme aber auch Teil der Frühfassung BWV 1019a der Sonate G-Dur für Cembalo und Violine gewesen war, gelangen in ihm Bachs Erfahrungen als Geiger, Tastenvirtuose, Komponist und Bearbeiter zu einer Synthese von traumhafter Eleganz. Selten wurden wohl Staatstheorie und gesellschaftlicher Zusammenhalt so inbrünstig besungen wie in der Vertonung des Psalmwortes «daß sich Recht und Treue müssen freundlich miteinander küssen» – womöglich fehlt es unserer heutigen Zeit medial aufgeheizter Konflikte an derlei gemeinschaftsstiftenden Zeremonien…
Das streicherbegleitete Tenorrezitativ bittet eindringlich darum, «daß alle Bosheit von uns fliehe und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe». Der Verweis auf die göttliche Letztbindung allen Regiments wird Bach umso leichter in die Feder geflossen sein, als auf den Ratsbänken zu St. Nikolai keineswegs nur Freunde des aus ihrer Sicht allzu eigensinnigen städtischen Musikdirektors sassen…
Im auf Martin Luthers deutsches Tedeum zurückgehenden Schlusschoral ist alle irdische Pracht dem verinnerlichten Gebet gewichen, das das christliche Gemeinwesen in eine konsequent jenseitige Perspektive stellt. Zu dieser alle Generationen übergreifenden Botschaft passt der archaische Tonfall der alten gregorianischen Melodie. Diesem verinnerlichten Satz haben wir in unserer Aufnahme eine von Thomas Leininger aus dem Material des Eingangschores entwickelte Bläserintrada nachgestellt. Sie deutet die Einbettung der Kantate in ein repräsentatives Gottesdienstgeschehen an und nimmt auf die Parallelfälle der zur Kantate BWV 207 gehörigen Marcia sowie der Schlussfanfaren der Ratswahlkantate BWV 69 Bezug.
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Arie — Alt
«Gott, man lobet dich in der Stille zu Zion, und dir bezahlet man Gelübde».
1. Arie
Die Eingangsarie des feierlichen Gottesdienstes zur Neukonstituierung und «Einweihung» des Rats bringt ein wörtliches Zitat aus Psalm 65, 2 – in dem die Themen der ganzen Kantate, das Gotteslob, der Dank, die Bitte um Schutz sowie das Halten der Gelübde, angesprochen sind –, denn das ist mit dem altertümlichen «Dir bezahlet man Gelübde» gemeint. Das im Psalmvers enthaltene Stichwort «Stille» leitete Bach zur ungewöhnlichen Entscheidung, die Festkantate nicht mit einem jubelnden Tuttisatz zu beginnen, sondern ihm eine Soloarie mit sprechenden Pausen und Fermaten vorzuschalten. Diese strahlt dank des schwingenden 6∕8-Taktes und der eleganten Instrumentierung mit Streichern und Oboen d’amore dennoch Freude und Liebreiz aus.
2. Chor
Jauchzet, ihr erfreuten Stimmen,
steiget bis zum Himmel ‘nauf!
Lobet Gott im Heiligtum
und erhebet seinen Ruhm;
seine Güte,
sein erbarmendes Gemüte
hört zu keinen Zeiten auf.
2. Chor
Der Chor antwortet mit der Aufforderung des unbekannten Textdichters, dieses Gotteslob mit Gesang darzubringen, dankbar und in der Gewissheit, dass Gottes Erbarmen nicht aufhören werde. In die Trompetentonart D-Dur versetzt, wirkt der Einsatz des vollen Orchesters als fanfarenglänzender Weckruf, der das «Jauchzen» wörtlich nachzeichnet und das gen Himmel gerichtete Gotteslob als sukzessives Aufsteigen erlebbar macht.
3. Rezitativ — Bass
Auf! du geliebte Lindenstadt,
komm, falle vor dem Höchsten nieder;
erkenne, wie er dich
in deinem Schmuck und Pracht
so väterlich
erhält, beschützt, bewacht
und seine Liebeshand
noch über dir beständig hat.
Wohlan,
bezahle die Gelübde, die du dem Höchsten hast getan,
und singe Dank- und Demutslieder;
komm, bitte, daß er Stadt und Land
unendlich wolle mehr erquicken
und diese werte Obrigkeit,
so heute Sitz und Wahl verneut,
mit vielem Segen wolle schmücken.
3. Rezitativ
Das Rezitativ vertieft und verdeutlicht mit dem Aufruf an die «Lindenstadt» (eine alte Etymologie Leipzigs aus dem Wendischen), im Gebet sich an die Erhaltung, den Schutz und die väterliche Vorsorge Gottes für Leipzig zu erinnern und darum zu bitten, dass der erneuerte Rat als Obrigkeit auch künftig unter Gottes Segen stehe.
4. Arie — Sopran
Heil und Segen
soll und muß zu aller Zeit
sich auf unsre Obrigkeit
in erwünschter Fülle legen,
daß sich Recht und Treue müssen
miteinander freundlich küssen.
4. Arie
Wenn Martin Petzoldts Vermutung zutrifft, dass die (nicht erhaltene) Predigt vor der Kantatenaufführung das Obrigkeitskapitel von Römerbrief 13 zur Grundlage hatte, so werden nun in der Sopranarie der Segen und die Verpflichtung für diese Obrigkeit näher bestimmt: «dass sich Recht und Treue müssen miteinander freundlich küssen» – eine Anspielung auf Psalm 85,11: «dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen». Der zugleich verzückt schimmernden wie in ihren Solofigurationen leichtfüssig beschwingten Arie merkt man ihre zwischenzeitliche Umwidmung zu einer Hochzeitsmusik an. Zudem hat Bach, der ja auch ein herausragender Geiger war, sie auch als Sonatensatz für Violine und Cembalo hinterlassen.
5. Rezitativ — Tenor
Nun, Herr, so weihe selbst das Regiment mit deinem Segen ein,
daß alle Bosheit von uns fliehe
und die Gerechtigkeit in unsern Hütten blühe,
daß deines Vaters reiner Same
und dein gebenedeiter Name
bei uns verherrlicht möge sein.
5. Rezitativ
Das Tenorrezitativ ist eine direkte Bitte an Gott, «das Regiment» mit seinem Segen zu weihen. So soll eine von Bosheit freie, in Gerechtigkeit erblühende Stadt ein Ort werden, an dem auf diese Weise Gottes Name verherrlicht wird. Der hinzugefügte Streichersatz verleiht der staatstheologischen Weihehandlung klingende Würde.
6. Choral
Nun hilf uns, Herr, den Dienern dein,
die mit dein’m Blut erlöset sein;
laß uns im Himmel haben Teil
mit den Heilgen im ewgen Heil.
Hilf deinem Volk, Herr Jesu Christ,
und segne, was dein Erbteil ist;
wart und pfleg ihr’ zu aller Zeit
und heb sie hoch in Ewigkeit.
6. Choral
Der Schlusschoral bringt mit einer Strophe aus dem von Luther übersetzten gregorianischen Loblied «Te Deum laudamus» («Herr Gott, dich loben wir») eine theologische Vertiefung und christologische Konkretisierung. Da dem Choral noch eine nicht erhaltene «Intrada con Trombe e Tamburi» folgte, darf man Bachs Option für einen schlicht instrumentierten vierstimmigen Liedsatz wohl als bewusst demütig gehaltene abschliessende Gebetsgeste verstehen.
Hermann Hess
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geschätzte Musikerinnen und Musiker,
lieber grosszügiger Konrad Hummler,
lieber hochmusikalischer Ruedi Lutz
Meine lieben verstorbenen Eltern waren Nachbarskinder, und sie verband insbesondere die Musik, indem beide Sänger und Klavierspieler waren. Mein Vater, der Unternehmer, besass sogar ein Operndiplom. So kamen wir bereits seit unserer frühen Kindheit in Kontakt mit dem Repertoire der romantischen Lieder. Darin fühlte ich mich später als Pianist stets zuhause und durfte zahlreiche Liederabende im Konzert begleiten, was ich immer sehr genoss. Ausserdem besassen meine Eltern die gesamte Ausgabe der Bach-Kantaten, in Leinen gebunden, und wir schauten immer wieder gemeinsam in die Noten und staunten über Bachs Vertonungskünste, wenn diese Musik im Radio und als Schallplatte erklang. Als Kind spielte ich besonders gerne Bach, und diese Vorliebe hat sich noch bis in das Musikstudium am Konservatorium Winterthur gehalten, wo ich übrigens dem Mitstudenten Ruedi Lutz begegnete.
Als die Ratswechselkantate vermutlich vor 1730 aufgeführt wurde, herrschte über Sachsen der König und Kurfürst Friedrich August I. (genannt «der Starke»), der gleichzeitig auch König von Polen war. Seine Regentschaft war geprägt von grosser wirtschaftlicher Dynamik, von Prunk und Festlichkeiten. Die Messestadt Leipzig florierte, verfügte bereits über eine Strassenbeleuchtung und verglich sich mit Paris. Friedrich Augusts Macht war absolut; als relativ erwies sie sich dann längerfristig insofern, als Sachsen von Preussen und Habsburg bedrängt wurde. Dieses Seilziehen endete 150 Jahre später mit dem Aufgehen des Kurfürstentums Sachsen im Deutschen Reich.
Bereits in den Jahrzehnten vor der Aufführung unserer Kantate, also um 1700, wetterleuchtete es am politischen Horizont. Der Dreissigjährige Krieg mit seinen ungeheuren Schrecknissen und Zerstörungen war erst 1648 zu Ende gegangen, knapp 40 Jahre vor Johann Sebastian Bachs Geburt. Die Bevölkerung hatte schwer gelitten. 1689, vier Jahre nach Bachs Geburt, hatte das englische Parlament in der «Glorious Revolution» dem König grössere Rechte abgerungen und damit eine konstitutionelle Monarchie begründet. Die Gedanken der Aufklärung bewegten zunehmend die Geister der gebildeten Menschen aller Länder. Nur 26 Jahre nach unserer Kantate wurde 1756 der Komponist Mozart geboren, welcher später den Diener Figaro sagen liess: «Se vuol ballare, signor contino, il chitarrino le suonerò», was doch ziemlich dicke Post in Richtung Obrigkeit bedeutete. 1774 sollte Goethe den «Werther» veröffentlichen, und 1776 sollte die Amerikanische und 1789 die Französische Revolution stattfinden. Doch in Leipzig herrschte vorerst noch Ruhe, der Rat wurde nicht von unten gewählt, sondern von oben bestimmt. Im Vertrauen auf Gott und begleitet von Gebeten äusserte das Volk in der Kirche lediglich seine Hoffnung auf die Weisheit und Korrektheit der Regierung. Im Kantatentext zeigt sich eine eigentümliche Ambivalenz, indem die Ehrfurcht vor dem «Höchsten» und der Dank des Volkes irgendwie auch an die Adresse der weltlichen Macht gerichtet zu sein scheinen. Gott und König waren gewissermassen eine gemeinsame Instanz.
Wörtlich heisst es da, recht holperig formuliert:
«Auf, du geliebte Lindenstadt,
Komm, falle vor dem Höchsten nieder,
Erkenne, wie er dich
In deinem Schmuck und Pracht
So väterlich
Erhält, beschützt, bewacht
Und seine Liebeshand
Noch über dir beständig hat.»
Und weiter wird appelliert an die Weisheit der Obrigkeit:
«Heil und Segen
Soll und muss zu aller Zeit
Sich auf unsre Obrigkeit
In erwünschter Fülle legen,
Dass sich Recht und Treue müssen
Miteinander freundlich küssen.»
Das ist sehr schön gesagt ‒ und noch schöner vertont. Bach hat diese Kantate zwar als dienstlichen Auftrag ausgeführt, dies aber unter Aufbietung seiner ganzen schöpferischen Kompetenz als Komponist. Was er selber zum Textinhalt gedacht hat, ist kaum bekannt. Gewiss war er ein tief gläubiger Christ, und er war kein Umstürzler; doch ist es unwahrscheinlich, dass ihm die Gedanken der Aufklärung nicht geläufig gewesen wären. Es scheint, dass er sich einerseits durchaus in das barocke Weltverständnis integriert hat, wie er auch seine sechs Brandenburgischen Konzerte ohne Weiteres in einen höfischen Zusammenhang eingebracht hat. Auch benutzen seine Suiten mit den traditionellen Teilen Allemande, Courante, Sarabande, Menuett und Gigue mindestens als Rahmen die höfischen Tänze. Durch diese Werke hindurch strahlt JSB jedoch als hochintelligenter, einerseits lebensfroher, musikantischer, rhythmischer und gleichzeitig tiefsinniger und feinfühliger Künstler, ein erkennbar extravertierter Mensch mit einer ausgeprägten Introversion. Es scheint, dass JSB sich andererseits zwei wichtige Fluchtwege aus der engen Barockgesellschaft offengehalten hat: das «Wohltemperierte Klavier» und die «Kunst der Fuge». Hier gibt es keine Kirche und keine Obrigkeit, sondern nur Musik, die sich in einem selbst gesetzten und sehr weitgesteckten Rahmen entfaltet in ihrer bis heute unvergleichlichen Freiheit und Schönheit und die sich eindeutig an den interessierten Kenner und Spieler wendet.
Gegen Ende von Bachs Leben beherrschte bereits die Frühklassik die Musikwelt und bescherte ihr die dialektische und freiheitsliebende Sonatenform – die Form der Aufklärung – mit These, Antithese und Synthese. Die Sonate konnte einerseits lieblich und unschuldig daherkommen, aber sie ermöglichte den Komponisten andererseits das Aufzeigen von dramatischen Gegensätzen, erschütternden Abgründen und formalen Überraschungen. Bis ins 20. Jahrhundert machten die Komponisten von diesem Konzept Gebrauch. JSB hat sich der Sonatenform im klassischen Sinn kaum mehr zugewandt. Er zog es vor, die mit der Kunst der Fuge angefangene Thematik konsequent und in ihrer ganzen Tiefe auszuschöpfen. Eine derartige Selbstbeschränkung ist immer wieder bei bedeutenden Künstlern wahrzunehmen, die sich dem jeweils aktuellsten Zeitgeist versagen, um sich letztlich selber treu zu bleiben. Hier kommt mir z.B. der russisch-amerikanische Maler Mark Rothko mit seiner Thematik der Farbfelder in den Sinn oder etwa der Schweizer Autor Friedrich Glauser mit seinen Kriminalromanen. Es gibt zahlreiche weitere Beispiele.
Doch zurück zu unserer Kantate. Sie beginnt mit einer Art Hirtenmusik, wie wir sie von Bach auch aus den Passionen kennen. Die Hirten als ärmste und anspruchsloseste Gruppe der Gesellschaft, beschäftigt mit dem Hüten der Schafe und dem täglichen Überleben. Ihnen war einst der Engel mit einer unglaublichen Botschaft erschienen: Ihr neu geborener König sollte in der Nähe in einer Krippe liegen! Letzteres verstanden sie zwar ohne Weiteres, denn ihre eigenen Kinder hatten auch in Krippen gelegen. In Sachsen sind die Hirten auf dem Feld wohl eher über eine Gruppe von Aushebungsoffizieren erschrocken, welche über Land gingen und junge Männer in die Armee des Königs pressten. Wie auch immer, die geduldigen Untertanen in der barocken Gesellschaft, für die hier das musikalische Bild der Hirten und ihrer noch geduldigeren Schafe herangezogen wird, beten nun also zunächst still in der Kirche für ihre Obrigkeit. Die Ratswechselkantate ist ein Bekenntnis zu den herrschenden Zuständen, verbunden mit der Hoffnung auf die Weisheit der Regierenden.
Doch dann ist überraschend früh Schluss mit Stille: Pauken und Trompeten, die Musikinstrumente des Militärs und der Herrschaft, bestimmen nun die festliche Atmosphäre, welche das Ritual des Ratswechsels begleitet. Auch das Weihnachtsoratorium beginnt mit Pauken und Trompeten: «Jauchzet, frohlocket!», ruft der Chor und verkündet damit eben, dass ein Fest angebrochen sei. Ein Fest in der Barockzeit dürfte in der Regel eine Bewilligung der Obrigkeit benötigt haben. Das Subversive und Revolutionäre am eben nicht bewilligten Weihnachtsgeschehen ist, dass der Herr in einer ärmlichen Krippe liegt und nicht auf dem glänzenden Thron sitzt. Die Pauken und Trompeten des Weihnachtsoratoriums für das Kind in der Krippe unterlaufen dort sozusagen die weltliche Herrschaftsstruktur der Barockzeit.
Diese Herrschaft tritt in Leipzig als neu eingewechselter Rat auf und lässt sich gerne feiern. Es ist wie etwa bei der jährlichen Wahl des Bundespräsidenten oder der Grossratspräsidentin: Der Vorgang ist ein Ritual, es gibt nichts Überraschendes zu erwarten, und das ist vielleicht das Beruhigende in einer schon damals sich rasch verändernden Welt. Immer wieder begrüssen wir freudig diese «Nichtsensationen» und erhoffen das Beste. Für einen gläubigen Menschen macht das Beten für die Weisheit und das Verantwortungsgefühl der Regierenden auch heute noch Sinn. Ironisch sagte Oliver Welke kürzlich in seiner Satiresendung «heute-show» im Zusammenhang mit den aktuellen Koalitionsverhandlungen in Deutschland: «Tatsächlich müssen wir bei einigen Themen als Bürger beten, dass sich die Parteien nicht zu 100 Prozent durchsetzen.» In der Ironie steckt immer ein kleines Quantum Ernst.
Nach dem Beten und Hoffen kommt das freudig erwartete Feiern. Damit überspringen die Menschen ihre damaligen wie heutigen stillen Bedenken über die Fähigkeiten und die Eignung der neuen Obrigkeit, ob wie damals nominiert oder wie heute gewählt, indem sie sich der Unterhaltung, dem Lärm und dem Genuss hingeben. Das ist sogar im Berner Bundeshaus der Fall: Wenn jeweils die neuen Bundesräte gewählt sind, gibt es kein Halten mehr; das feuchtfröhliche Feiern dauert mindestens dreimal so lange wie das Wahlgeschehen. Dagegen war und ist nichts, aber auch gar nichts einzuwenden. Auch die damaligen Leipziger Musiker werden nach dem Gottesdienst wohl eiligst ihre Noten und Instrumente zusammengepackt und sich hinaus ins Getümmel des Fests gestürzt haben, mit Bier, Leipziger Bratwürsten und Tanzmusik! Und ich stelle mir vor, dass auch der Kantor da mit dabei war.
Lassen Sie uns also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zurückkehren zu unserer Kantate: für eine kurze Andacht und zu einem langen fröhlichen Fest!