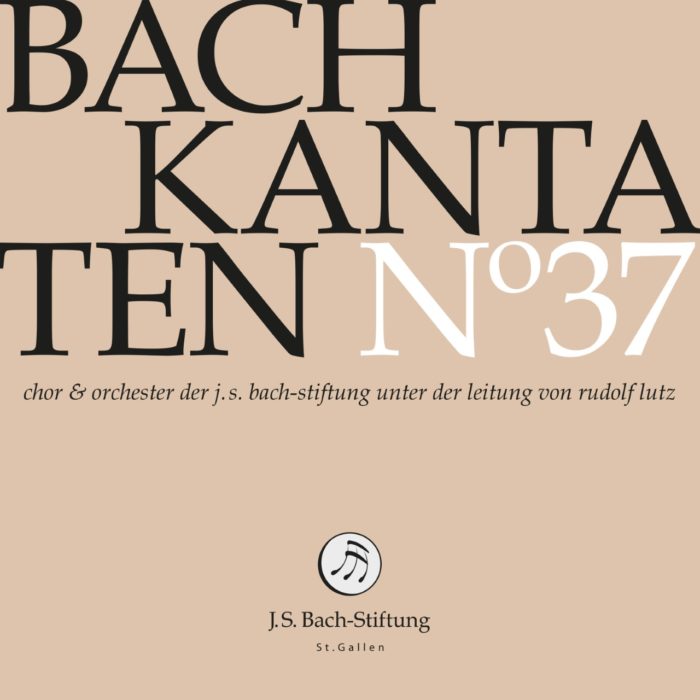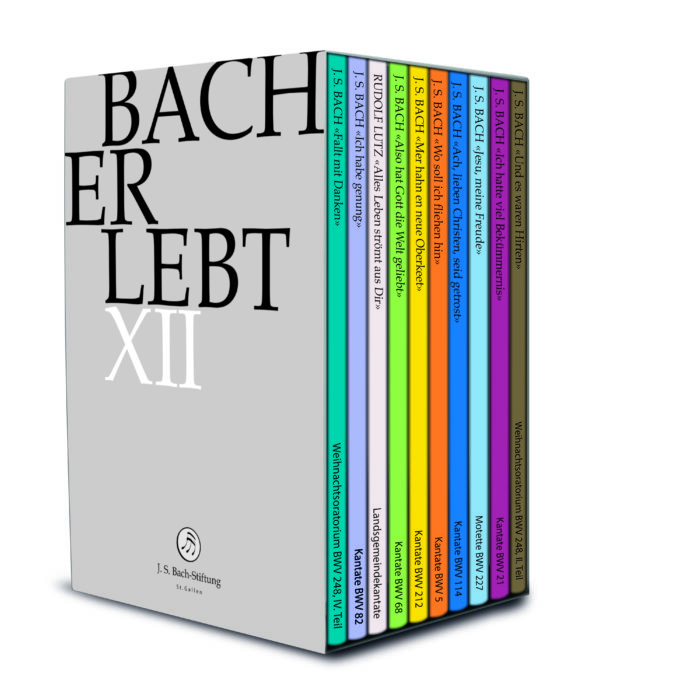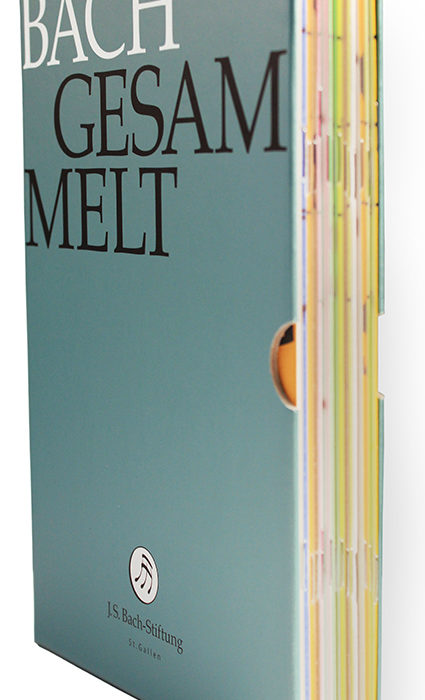Wär Gott nicht mit uns diese Zeit
BWV 014 // zum 4. Sonntag nach Epiphanias
für Sopran, Tenor und Bass, Vokalensemble, Corno, Oboe I + II, Streicher und Basso continuo
Die 1735 als Nachzügler dem Bach’schen Choraljahrgang von 1724/25 hinzugefügte Kantate über Luthers Psalmlied «Wär Gott nicht mit uns diese Zeit» (BWV 14) gehört zu Bachs spätesten Kompositionen für den Leipziger Gottesdienst. Dass anders als bei den Kantaten der frühen Leipziger Jahre nicht nur die Partitur, sondern auch die meisten Stimmen von Bachs eigener Hand stammen, könnte darauf hindeuten, dass sich im Zuge seiner partiellen Distanzierung vom wöchentlichen Dienstbetrieb auch gewisse Arbeitsroutinen seiner bewährten «Schreiberwerkstatt» verändert hatten. Die Kantate profitiert dennoch sowohl von Bachs reichhaltiger kompositorischer Erfahrung wie von seinen Mitte der 1730er Jahre erweiterten stilistischen Interessen. Entsprechend verknüpft insbesondere der von Singstimmen mit verdoppelnden Instrumenten bestrittene g-Moll-Eingangschor eine motettische Anlage von ausgeprägter fugenmässiger Komplexität mit einer empfindsam rhythmisierten Linienführung der Einzelstimmen. In experimenteller Weise ist auch der Sopran in die verschlungene Kontrapunktik einbezogen, während der eigentliche Cantus firmus wortlos vom Horn und zwei Oboen vorgetragen wird. Wie unterschiedlich sich das menschliche Vertrauen auf Gottes schützende Macht äussern kann, wird in den beiden Arien offenbar, die aus der von fern hörbaren Präsenz der himmlischen Heerscharen Trost ob der eigenen Schwäche ziehen sowie aus dem eindringlichen Zuspruch zweier Oboen innerliche Kraft schöpfen.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Chor
Sopran
Alice Borciani, Cornelia Fahrion, Olivia Fündeling, Susanne Seitter, Noëmi Sohn Nad, Baiba Urka
Alt
Laura Binggeli, Antonia Frey, Francisca Näf, Alexandra Rawohl, Simon Savoy
Tenor
Clemens Flämig, Zacharie Fogal, Joël Morand, Sören Richter
Bass
Fabrice Hayoz, Grégoire May, Daniel Pérez, William Wood
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Eva Borhi, Lenka Torgersen, Peter Barczi, Christine Baumann, Ildikó Sajgó, Judith von der Goltz
Viola
Martina Bischof, Matthias Jäggi, Sarah Mühlethaler
Violoncello
Maya Amrein, Daniel Rosin
Violone
Guisella Massa
Oboe
Andreas Helm, Thomas Meraner
Corno
Stefan Katte
Fagott
Gilat Rotkop
Cembalo
Thomas Leininger
Orgel
Nicola Cumer
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Rudolf Lutz, Pfr. Niklaus Peter
Reflexion
Referent
Eduard Käser
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
18.02.2022
Aufnahmeort
Trogen (AR) // Evangelische Kirche
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Erste Aufführung
30. Januar 1735, Leipzig
Textdichter
Martin Luther (Sätze 1 und 5), unbekannt (Sätze 2–4)
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
Die Kantate BWV 14 wurde laut Bachs eigenhändigem Vermerk am Ende der Originalpartitur für die Erstaufführung am 30. Januar 1735 komponiert. Als nachträglicher Lückenschluss zum Choralkantatenjahrgang von 1724/25, der ursprünglich keine Komposition zum 4. Sonntag nach Epiphanias enthalten hatte, gehört sie zu Bachs spätesten Kirchenkantaten überhaupt. Es passt dabei sowohl zu dem besonders alten und von Martin Luther höchstpersönlich herrührenden Choral als auch zu Bachs in den 1730er-Jahren verstärktem Interesse am alten Kontrapunktstil, dass der Eingangschor nicht dem konzertanten Orchesterstil der meisten Choralkantaten folgt, sondern die Form einer polyphonen Vokalmotette ausbildet. Doch zeigt sich die Weiterentwicklung der Bach‘schen Kunst seit den 1720er-Jahren auch darin, dass er bei der Verdoppelung der Singpartien durch die Streicherstimmen nicht stehen bleibt, sondern den Satz durch Übertragung des Choral-Cantus-firmus an zwei Oboen und einen Zink zur realen Fünfstimmigkeit steigert. Zudem erhält die Linienführung aller Stimmen durch chromatische Schärfungen sowie effektvolle Synkopenrhythmen und Vorhalte einen Zug ins affektdeutend Galante, was dieses Meisterwerk einer reizvollen Spannung zwischen archaischem Grundidiom und elegisch ausgekosteter Modernität aussetzt.
Die folgende Sopranarie scheint hingegen gänzlich in der auch tonal eindeutigen Klangwelt des Spätbarock angesiedelt. Der fanfarenartige Duktus der vom Streichorchester begleiteten Blechbläserpartie mobilisiert im Verein mit der beweglichen Sopranstimme eine erhebliche kämpferische Energie, die die besungene menschliche «Stärke» nach besten Kräften evoziert, nur um deren Unzulänglichkeit gegenüber Gott und den seiner Schöpfung widerstrebenden Feinden umso deutlicher werden zu lassen. Dass in diesem wuchtigen Szenario vor allem im Mittelteil immer wieder verinnerlichte Töne hörbar werden, gehört zur plastischen Affektzeichnung des reifen Bach dazu.
Das Tenorrezitativ radikalisiert diese in der Arie noch verdeckt angedeutete Botschaft zu einer schonungslosen Bilanz – ohne Gott, ohne den tätigen Schutz dieses mächtigsten aller Waffenbrüder wären alle Menschen dem im wüsten Auf und Ab der Continuolinie ablesbaren und in ein finsteres d-Moll stürzenden Treiben des Widersachers hilflos ausgeliefert und womöglich «längst nicht mehr am Leben».
Dass nach derlei Schreckensszenarien sanftere Register angezeigt sein würden, liess sich mit Blick auf die typische «Licht-Nacht- Dramaturgie» der meisten barocken Kantaten und Opern erwarten. Bach kommt diesem verständlichen Hoffen in der folgenden Bassarie durchaus entgegen, gibt aber im pathetischen g-Moll und angesichts des streng imitativen Charakters der drei Begleitstimmen Oboen I/II und Continuo in nichts nach, was die Ernsthaftigkeit der Bedrohung betrifft. Entsprechend wirkt die vokale Kantilene keineswegs wie ein befreites Aussingen, sondern wie eine zum Durchhalten auffordernde Beschwörung hinter einer dreifach befestigten Verteidigungslinie, deren rettender Feuerschutz in jedem Moment erforderlich sein könnte. Dass es über die Hoffnung auf ein besseres Jenseits hinaus auf Erden womöglich keine wirkliche (Er-)Lösung geben könnte, tönt in den verschlungenen Girlanden dieser verzweifelt tapferen Musik zumindest an.
Entsprechend kämpft sich der orchesterbegleitete Schlusschoral über schmerzliche Halbtöne energisch nach oben. Martin Luthers drastische Sprachbilder passen dabei zu einer Atmosphäre existentieller Anfechtung, in der es sich wie in unserer aktuellen Welt letztlich auf Risiko hin zu entscheiden gilt. Bachs in der gesamten Kantate schnörkellos zielführende Musik drängt sich da nicht genussvoll dazwischen, sondern unterstreicht den Impuls dieses apodiktischen «Jetzt oder nie».
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Chor
Wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
so soll Israel sagen,
wär Gott nicht mit uns diese Zeit,
wir hätten müssen verzagen,
die so ein armes Häuflein sind,
veracht’ von so viel Menschenkind,
die an uns setzen alle.
1. Chor
Die erste (und die dritte) Strophe dieses frühen, von Luther nach Psalm 124 gedichteten dreistrophigen Liedes bilden den Rahmen dieser späten Kantate Bachs für den 4. Sonntag nach Epiphanias (aufgeführt am 30. Januar 1735). Mit ihr endet der Weihnachtsfestkreis, der Blick wendet sich schon hin auf die Passions- und Leidenszeit. Das Thema deshalb: Gottvertrauen in schwierigen Zeiten, damals in Israel, später in den Bedrohungen der Reformationszeit. Dass Bachs Zeitgenossen dies hörend auf den Kontext des polnischen Thronfolgekrieges (1733–1738) übertrugen, ist durchaus denkbar. Anhand der latent archaischen Satzform einer nur instrumental verdoppelten Motette lässt Bach trotz der Geschmeidigkeit der vokalen Linienführung die Traditionstiefe der Luther’schen Psalmparaphrase ohrenfällig werden. Mit der ausserordentlichen Kunstfertigkeit des von Beginn an mit paarweisen Umkehrungen arbeitenden Kontrapunktes sowie der Zuweisung des eigentlichen Cantusfirmus-Vortrags an Oboen und Horn entwickelt Bach das Satzkonzept des Choraljahrgangs kreativ weiter und blickt bereits auf spätere Werke wie die «Kunst der Fuge» und das siebenstimmige Credo der h-Moll-Messe voraus.
2. Arie — Sopran
Unsre Stärke heißt zu schwach,
unserm Feind zu widerstehen.
Stünd uns nicht der Höchste bei,
würd uns ihre Tyrannei
bald bis an das Leben gehen.
2. Arie
Beim Text des zweiten (dritten und vierten) Satzes der Kantate handelt es sich um Paraphrasen der mittleren Strophe des Lutherliedes: hier das Motiv der Klage angesichts der eigenen Schwäche in existenziellen Bedrohungen und Dankbarkeit für Gottes Beistand. Nach dem kontrapunktischen Kraftakt des Eingangschores gibt sich die Sopranarie betont modern und zugänglich. Dass selbst die markanten Fanfarenklänge der mit einer obligaten Hornpartie ausgestatteten Arie als «zu schwach» bezeichnet werden, um dem Drohen des Feindes zu widerstehen, verleiht dem auf den allein rettenden Beistand des Höchsten verweisenden Textsinn eine reizvolle Pointe.
3. Rezitativ — Tenor
Ja, hätt es Gott nur zugegeben,
wir wären längst nicht mehr am Leben,
sie rissen uns aus Rachgier hin,
so zornig ist auf uns ihr Sinn.
Es hätt uns ihre Wut
wie eine wilde Flut
und als beschäumte Wasser überschwemmet,
und niemand hätte die Gewalt gehemmet.
3. Rezitativ
Das Rezitativ bezeichnet die Gefahren: die Rachgier und die gewalttätige Wut der Feinde, die «uns» wie eine unüberwindliche Flutwelle «überschwemmet», wenn Gott diese nicht «gehemmet» hätte. Die dramatisch-nautische Metaphorik ist angesichts des Evangelientextes für jenen Sonntag von der Stillung des Seesturmes (Matthäus 8, 23–27) ausgesprochen passend. Die im Text hervorgehobenen Wasserfluten deutet Bach im geschwinden Aufs und Abs der Generalbasslinie wirkungsvoll an.
4. Arie — Bass
Gott, bei deinem starken Schützen
sind wir vor den Feinden frei.
Wenn sie sich als wilde Wellen
uns aus Grimm entgegenstellen,
stehn uns deine Hände bei.
4. Arie
Die Bassarie gibt der Dankbarkeit gegenüber Gott Ausdruck für seinen Schutz und seine helfende Hand angesichts von Turbulenzen der Gegenwart, wie es im Psalm 124, 6 heisst: «Gelobet sei der Herr, dass er uns nicht gibt zum Raube in ihre Zähne.» Trotz der lieblichen Klangfarbe der Oboen ist die Arie als Trio zweier imitierender Oberstimmen über einem emsig laufenden Bass von ausgemacht ernstem Charakter: Auch Gottes «starkes Schützen» erspart dem Menschen nicht die Vertracktheiten und Kämpfe eines allezeit angefochtenen Daseins.
5. Choral
Gott Lob und Dank, der nicht zugab,
daß ihr Schlund uns möcht fangen.
Wie ein Vogel des Stricks kömmt ab,
ist unsre Seel entgangen.
Strick ist entzwei und wir sind frei,
des Herren Name steht uns bei,
des Gottes Himmels und Erden.
5. Choral
Die Kantate schliesst mit der integralen dritten Strophe des Lutherliedes, welche die Thematik des ganzen Liedes zusammenfasst: Lob und Dank für die Bewahrung und Befreiung aus Gefahren, nun auch ins Individuelle gewendet mit dem schönen Bild von der Seele, die den Netzen des Vogelfängers entkommt und frei ist.
Eduard Käser
«Wär Gott nicht mit uns diese Zeit…»
«Wär Gott nicht mit uns diese Zeit» ‒ im Text der Kantate fällt der Konjunktiv auf: «wäre», «hätte», «würde», «stünde». Der Konjunktiv drückt Zuspruch aus, Dank, Mutmachen, aber auch Auserwähltsein. Zudem könnte man darin eine Art von Gottesbeweis sehen: Gäbe es Gott nämlich nicht, dann wäre das Volk Israel – wie der Chor singt ‒ «längst nicht mehr am Leben». Nun ist es aber am Leben, also gibt es Gott, den Beschützer. Die Existenz der Israeliten ist «Evidenz» für Gottes Beistand. Das klingt plausibel, aber die Logik dieses Umkehrschlusses ist brüchig – und sie neigt auch zu Dogmatismus. Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Glauben ist schliesslich keine Sache der «Evidenzbasierung».
Der Text sagt mir spontan aus einem anderen Grund zu. Ich liebe den Konjunktiv. Die Formel «Was wäre, wenn…?» oder «Was wäre, wenn nicht…?» gehört seit dem Studium der theoretischen Physik zu meinem Denkbesteck. Ich möchte mich deshalb – für Sie auf Anhieb vielleicht etwas ungewohnt – in der folgenden Viertelstunde etwas näher mit diesem wunderbaren Instrument des Konjunktivs befassen. Und es werden nicht grammatikalische Überlegungen sein.
***
Physikalisches zuerst. Die theoretische Physik treibt in ihren Modellen eigentlich immer ein Was-wäre-wenn-Spiel, sie jongliert mit Hypothesen. Heute im kosmischen Format. Warum ist die Welt so, wie sie ist? Die Physiker beantworten die Frage gern über den Umweg des Konjunktivs. Wie Sie wissen, geht das Standardmodell der Kosmologie von einem Urknall aus. Er stellt nichts anderes als eine primordiale Energiequelle dar. Aus ihr entstehen die Elementarteilchen, expandiert das Universum.
Und hier argumentieren die Physiker formal ganz ähnlich wie der Kantatentext. Sie sagen natürlich nicht: «Wär Gott nicht mit uns…», sie sagen: «Hätte am Anfang des Universums nicht ein ganz bestimmtes Verhältnis von Energiedichte und Expansionsrate bestanden, gäbe es keine Galaxien, Sterne, Planeten und Physiker, die über dieses Verhältnis rätseln.» Tatsächlich gab es in der Geschichte des Universums, vom Urknall bis zu uns heute in diesem Raum, eine ungeheure Zahl von unwahrscheinlichen Feinabstimmungen, sodass sich die Frage fast unweigerlich aufdrängt, ob denn all diese Unwahrscheinlichkeiten nur dem Zufall zu verdanken seien oder ob doch nicht so etwas wie eine unerforschliche Regie das Ganze gesteuert habe. Sie kennen wahrscheinlich die Debatte um das sogenannte Intelligent Design. Das ist zwar nicht mehr Stoff für die Physik, aber bei solchen Ursprungsfragen rutschen nicht wenige Physiker – ob sie wollen oder nicht ‒ von der Physik in die Metaphysik.
***
Bleiben wir auf weniger glitschigem Boden. Zum Beispiel auf dem Boden der Geschichte. Auch die Historiker stellen die Was-wäre-wenn-Frage. Zum Beispiel der Brite Niall Ferguson. Er hat die sogenannte «virtuelle Geschichte» in die Diskussion gebracht, also das Durchspielen von Szenarien und Abläufen, wie sie hätten geschehen oder nicht geschehen können. Was wäre, wenn man Jesus Christus nicht gekreuzigt hätte? Wahrscheinlich gäbe es keine Märtyrer, keine Kreuzzüge, keine Kirchenmusik, keine Bachkantate 14, keinen Vortrag in Trogen. Viele Historiker rümpfen die Nase. Das sei doch lächerliche, müssige Fiktion, und ohnehin bestünde ihr Geschäft primär in der Aufzeichnung dessen, was gewesen und geschehen sei. Aber der pfiffige Ferguson wollte genau dieses kanonische Selbstverständnis herausfordern. Historische Fakten sind nicht unerschütterlich, sie sind immer interpretiert, als wie objektiv man sie auch darstellt. Geschichtsschreibung ist letztlich Erzählung.
Die virtuelle Geschichte richtet sich also nicht gegen die Objektivität historischer Fakten, sondern gegen eine allzu rigide, eine «deterministische» historische Sicht der Dinge; gegen die Idee, wir könnten uns nicht den Verstrickungen der Ereignisse entwinden. Es musste nicht notwendig so kommen, wie es gekommen ist. Geschichte ist immer faktisch unterbestimmt. Wir wissen bestürzend wenig über die Vergangenheit. Und wir kompensieren dieses Unwissen mit Was-wäre-wenn-Denken. Man sollte das nur zugeben. Das kann Blockaden lösen, Horizonte öffnen. Was sich anders vorstellen lässt, lässt sich auch anders gestalten. Deshalb tut es der Historiografie gut, mit einer Prise Phantasie-Salz gewürzt zu werden.
***
Unser ganzes Leben besteht aus Was-wäre-wenn-Geschichten, im Philosophenjargon: aus kontrafaktischen Szenarien. Die Fähigkeit, zwischen dem Faktischen und dem Kontrafaktischen zu unterscheiden, dürfte ein Alleinstellungsmerkmal des Menschen sein. Alle anderen Tiere nehmen wahr, was ist, wir nehmen auch wahr, was sein könnte. Wir leben immer in virtuellen Welten, auch schon vor dem Metaversum von Facebook. Das Was-wäre-wenn-Denken ist die Wurzel von Wissenschaft, Technologie, Literatur, überhaupt aller Kreativität und Kultur. Es kann faktenbasiert sein – oft eine Notwendigkeit ‒, es kann auch ohne Fakten auskommen oder sich gar gegen Fakten richten. Wir nennen dies neuerdings alternative Fakten. Ein Wörterbuch für Neologismen bezeichnet alternative Fakten als falsche Information, die sich als andere Sichtweise geltend macht. Alternative Fakten sind typische «Für-mich»-Fakten, solche, die meine Sichtweise bestätigen. «Die Erde ist flach»: falsch. «Für mich ist die Erde flach»: alternativ. Aber Vorsicht, die Floskel kann nach hinten ausschlagen. Dann lautet sie simpel: «Ich bin ein Flachkopf.»
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass wir kontrafaktische Szenarien als halbreal erfahren. David Hume, einer der ersten kritisch-philosophischen Vermesser des menschlichen Verstandes, bringt in seinem «Traktat über die menschliche Natur» das Beispiel eines Mannes im Eisenkäfig, der in luftiger Höhe an einem Turm sicher befestigt ist. Trotz der Sicherheit könne sich dieser Mann des Zitterns nicht erwehren. Warum nicht? Weil er sich durchaus vorstellen kann, hinunterzufallen. Unser Vorstellungsvermögen übersteigt immer die Grenzen der realen Situation. Und es kann uns zittern machen. Gefühle unterscheiden nicht zwischen Fakt und Fake. Deshalb zielen Desinformationskriege primär auf Emotionen. Wie ein anderer Brite, der Dichter T.S. Eliot, schrieb: «Die Menschheit erträgt nicht allzu viel Wirklichkeit.» Ich weiss nicht, aber ist das nicht die perfekte Charakterisierung unserer Situation heute?
***
Humes Beispiel führt mich zu einem weiteren Aspekt des Was-wäre-wenn. Der Kantatentext sagt ja ausdrücklich: Wir Israeliten sitzen in der Bredouille, und was wäre, wenn Gott uns nicht beistünde. Diese Denkfigur geht also von der realen Bedrohung der Feinde aus: «Sie rissen uns aus Rachgier hin, so zornig auf uns ist ihr Sinn.» Nun gibt es die Umkehrung, die mit der imaginären Bedrohung spielt: Wir sitzen zwar nicht aktuell in der Bredouille, aber was wäre, wenn uns eine solche drohte? Mir scheint, wir müssen uns jetzt nach der Aufhebung der Pandemiemassnahmen unbedingt diese Frage angewöhnen. Die Denkfigur ist antik. Sie stammt aus der griechischen Schule der Stoiker und nennt sich Vorwegnahme des Schlimmen – praemeditatio malorum. Was wäre, wenn das Schlimme, das Schlimmstmögliche einträte? Was wäre, wenn neue Coronavarianten auftauchen würden?
Die Stoiker sahen darin nicht Angstmache, sondern im Gegenteil: eine Übung der Angstmilderung. Sich das Schlimme vorstellen bedeutet ganz einfach Wechsel von der Betroffenen- zur Beobachterperspektive. Ich gebe Ihnen ein Beispiel des Römers Seneca. Eines seiner berühmten Werke sind die Briefe an Lucilius, praktische Ratschläge an einen jüngeren Gesprächspartner. Der 24. Brief handelt von einem Rechtsstreit, in dem Lucilius sich vor der Vergeltung seines Widersachers fürchtet. Seneca empfiehlt den Perspektivenwechsel: «… ich will dich auf einem anderen Weg zur Seelenruhe führen. Wenn du dich aller Bekümmernis entledigen willst, so stelle dir alles, was du befürchtest, als wirklich bevorstehend vor; miss bei dir selbst die Grösse des Übels ab, was es auch sei, und bringe deine Furcht auf die Waage: Du wirst gewiss finden, dass entweder nicht wichtig oder nicht von Dauer ist, was du fürchtest.»
Anders gesagt: Wenn man sich das Schlimmste vorstellen kann, kann man sich auch Auswege vorstellen. Der Stoiker will sich nicht unnötig Sorgen aufhalsen – dann wäre er Neurotiker ‒, sondern die Wirklichkeit um das Imaginäre erweitern. Das Imaginäre schärft den Blick für das Wirkliche. Ali S. Khan, ehemaliger Direktor der amerikanischen Behörde zum Schutz der öffentlichen Gesundheit, wurde im Mai 2020 zur desaströsen Entwicklung von Covid-19 in den USA befragt. «War es ein Mangel an wissenschaftlicher Information oder ein Mangel an Geld?», wollte der Interviewer wissen. Khans Antwort: «Ein Mangel an Imagination.»
***
Kurz: Die Welt ist nicht einfach, was der Fall ist. Die Welt ist alles, was uns erwartet. Also mehr, als wir erwarten, erwarten können. «Diese Zeit…» ‒ die Zeit der Pandemie ‒ hat uns zur Genüge die unberechenbare Komplexität der Ereignisse und ihrer Folgen vordemonstriert. Lange war ungewiss, ob ich meine Reflexion hier in Trogen vortragen kann. Nun haben Sie sie gehört. Und wir könnten geneigt sein, dieses Geschehen auch im Sinne des Kantatentextes zu deuten, als «Wär nicht ein Gott mit uns…» ‒ Mir fehlt allerdings diese Gläubigkeit. Aber ich höre sie in Bachs Musik anklingen, als eine Art von Gelassenheit, von Weltdemut, vielleicht sogar von säkularer Religiosität. Eine innere Festigung aus dem Konjunktiv. Ich glaube, wir werden sie in Zukunft schwer benötigen.