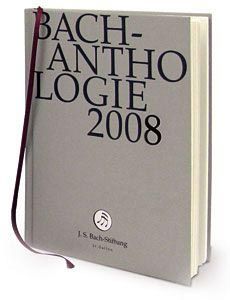Gott soll allein mein Herze haben
BWV 169 // zum 18. Sonntag nach Trinitatis
für Alt, Vokalensemble, Oboe I+II, Taille, Streicher und Continuo
Wie etliche Kirchenstücke des Jahrgangs 1726/27 als Solokantate (mit vierstimmigem Schlusschoral) angelegt, spricht die Kantate BWV 169 für eine Akzentverschiebung innerhalb des Bachschen Komponierens und für das Vorhandensein geeigneter Vokalisten im Chorus musicus dieses Schuljahres.

Möchten Sie unsere Videos werbefrei geniessen? Jetzt YouTube Premium abonnieren ...
Werkeinführung
Reflexion
Bonusmaterial
Solisten
Alt/Altus
Claude Eichenberger
Chor
Sopran
Susanne Frei
Tenor
Walter Siegel
Bass
Fabrice Hayoz
Orchester
Leitung
Rudolf Lutz
Violine
Renate Steinmann, Martin Korrodi
Viola
Susanna Hefti
Violoncello
Maya Amrein
Violone
Iris Finkbeiner
Oboe
Martin Stadler, Luise Baumgartl
Taille
Dominik Melicharek
Fagott
Susann Landert
Theorbe
Juan Sebastian Lima
Orgel
Rudolf Lutz
Musikal. Leitung & Dirigent
Rudolf Lutz
Werkeinführung
Mitwirkende
Karl Graf, Rudolf Lutz
Reflexion
Referent
Christian Lucas Hart Nibbrig
Aufnahme & Bearbeitung
Aufnahmedatum
19.09.2008
Aufnahmeort
Trogen
Tonmeister
Stefan Ritzenthaler
Regie
Meinrad Keel
Produktionsleitung
Johannes Widmer
Produktion
GALLUS MEDIA AG, Schweiz
Produzentin
J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen, Schweiz
Textdichter
Textdichter Nr. 1-6
Christoph Birkmann
Textdichter Nr. 7
Martin Luther, 1524
Erste Aufführung
18. Sonntag nach Trinitatis,
20. Oktober 1726
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Werk
Die repräsentative Einleitung durch eine ausgedehnte Sinfonia vermag die reduzierte Vokalbesetzung wirkungsvoll zu kompensieren. Bach griff dafür auf einen älteren Konzertsatz für ein bisher unbekanntes Soloinstrument zurück, der dann gemeinsam mit Satz fünf dieser Kantate Ende der 1730er Jahre seinen Weg in das Konzert E-Dur für Cembalo und Orchester (BWV 1053) fand. Die der Orgel übertragene Solostimme wurde in unserer Kantate offenbar direkt aus der Partitur gespielt, was an Bach selbst als virtuosen Ausführenden denken lässt.
Nach dem ausgreifenden Eingangssatz beginnt das Arioso mit einem längeren Continuoritornell, das sich als entspannter Rahmen für die kantabel vorgetragene Devise «Gott soll allein mein Herze haben» erweist. Die dazwischengeschalteten rezitativischen Betrachtungen sind hingegen bildhaft gehalten. Mit der Arie Nr. 3 gingen Librettist und Komponist ein Wagnis ein, beginnt sie doch erneut mit der bereits mehrfach gehörten Devise. In seiner neuen Vertonung kombiniert Bach einen schreitenden Bass mit einer nervig-gespannten und in ihren Synkopen fast jazzartigen Orgelpartie, denen der Solist seine hymnische Gesangslinie entgegensetzt. Nach dem kontrastreichen Selbstgespräch des Ariosos hören wir hier sozusagen das öffentliche Bekenntnis zum Bibelwort als Lebensmaxime.
Das Altrezitativ Nummer 4 gibt sich trotz seiner Kürze als inhaltsreiche Collage von Bildern und Attributen, die die göttliche Liebe und ihre Bedeutung für das menschliche Dasein ausdrücken – von Abrahams Schoss bis zu Elias’ Wagen wird dabei ein sprachlicher Ton angeschlagen, der auf die Passion verweist. Die folgende Arie «Stirb in mir, Welt!» greift diesen Duktus mit ihrer entrückten Sicilianoform und der «Erbarme dich!»-Tonart h-Moll auf. Das Zusammenspiel der Stimmen einschliesslich der Orgel ist dabei von solcher Eindringlichkeit, dass man gegenüber der etwas plakativen Lustverachtung des Textes doch an eine frühere Entstehung dieses Satzes denken möchte. Der Vergleich mit der späteren Fassung als Mittelstück des Cembalokonzertes E-Dur zeigt dabei ein weiteres Mal, wie aufwendig und sensibel Bach bei seinen Parodien vorging.
Das folgende Rezitativ lenkt unvermittelt den Blick von der jenseitstrunkenen Weltabsage des «religiösen Spezialistentums» auf die im Hier und Jetzt unerlässliche Aufmerksamkeit den Mitmenschen gegenüber. Der etwas trockene Verweis auf das entsprechende Schriftgebot offenbart eine Schwachstelle der lutherischen Ethik: Wo soll, wenn die guten Werke der Barmherzigkeit nicht mehr heilsnotwendig sind, die Motivation zur Nächstenliebe herkommen? Auf dieses Dilemma gibt der Schlusschoral eine berührende Antwort, indem er im leuchtenden A-Dur jene brünstige «Süsse» besingt, die der gelebten Brüderlichkeit und Herzensgüte innewohnt. Bach hat hier mit den Mitteln der Musik Tugend in Sinnlichkeit verwandelt. Durch ihre Identität als Kyrie-Lied (sog. «Leise») erhalten Choralsatz und Textaussage dabei liturgischen Nachdruck.
Text des Werks und musikalisch-theologische Anmerkungen
1. Sinfonia
2. Arioso & Rezitativ
Gott soll allein mein Herze haben.
Zwar merk ich an der Welt,
die ihren Kot unschätzbar hält,
weil sie so freundlich mit mir tut,
sie wollte gern allein
das Liebste meiner Seele sein;
doch nein: Gott soll allein mein Herze haben,
ich find in ihm das höchste Gut.
Wir sehen zwar
auf Erden hier und dar
ein Bächlein der Zufriedenheit,
das von des Höchsten Güte quillet:
Gott aber ist der Quell, mit Strömen angefüllet,
da schöpf ich, was mich allezeit
kann sattsam und wahrhaftig laben.
Gott soll allein mein Herze haben.
3. Arie
Gott soll allein mein Herze haben,
ich find in ihm das höchste Gut.
Er liebt mich in der bösen Zeit
und will mich in der Seligkeit
mit Gütern seines Hauses laben.
4. Rezitativ
Was ist die Liebe Gottes?
Des Geistes Ruh,
der Sinnen Lustgeniess,
der Seele paradies,
sie schliesst die Hölle zu,
den Himmel aber auf;
sie ist Elias Wagen,
da werden wir in Himmel nauf
in Abrahms Schoss getragen.
5. Arie
Stirb in mir,
Welt und alle deine Liebe,
dass die Brust
sich auf Erden für und für
in der Liebe Gottes übe,
stirb in mir,
Hoffart, Reichtum, Augenlust,
ihr verworfnen Fleischestriebe!
6. Rezitativ
Doch meint es auch dabei
mit eurem Nächsten treu;
denn so steht in der Schrift geschrieben:
Du sollst Gott und den Nächsten lieben.
7. Choral
Du süsse Liebe, schenk uns deine Gunst,
lass uns empfinden der Liebe Brunst,
dass wir uns von Herzen einander lieben
und in Friede auf einem Sinn bleiben.
Kyrie eleis.
Christiaan Lucas Hart Nibbrig
«Über Gott und die Welt und was dazwischen kommt»
Die Musik, die eben in der Stille verklungen ist, aus der Johann Sebastian Bach sie hat erstehen lassen – für ihn wohl eine unermesslich volle, tiefe Stille –, diese Musik hat mir, wenn ich es so sagen darf, erst das Herz geöffnet für den gesungenen Text, der mir ohne sie, die ihn beatmet und verlebendigt, als ein bloss gelesener Text fremd und wie eine am Strand meines Lebens mehr oder weniger zufällig angeschwemmte Muschel verschlossen geblieben wäre: ein abgelebtes Relikt barocker, möglicherweise sogar neobarocker Frömmigkeit, dachte ich zunächst, im schlimmeren Falle sogar, in der Klischeehaftigkeit seiner Bilder, ein Dokument barockisierender Neofrömmigkeit von vorgestern. Kaum brauchbar für die Welt, in der es, für die es heute und morgen gemeinsam zu Leben gilt. Wie gut, dass der Verfasser anonym ist und ich ihm nicht ins Gesicht sehen muss, wenn ich sage, was, bevor ich die Vertonung gehört hatte, meine erste Lesereaktion war: Was soll ich denn, mein Gott, nur anfangen mit dem rettenden Fluchtangebot dieser aus heiterem Himmel herunterhängenden Strickleiter in Bezug auf die sogenannte «böse Zeit», meine Zeit, den «Kot» der Welt, meine Lebenswelt mit ihren angeblich «verworfnen Fleischestrieben» ? und: Wer hat das Recht, und schon gar, wenn er vor ein paar hundert Jahren so gepredigt hat, diese meine Welt im Namen der Werte von damals heute noch schlecht und schmutzig zu reden? Wie soll ich das in seinem Anspruch, wie es scheint, allein seligmachende Sinnangebot solcher radikalen Vertikalität jungen Menschen von heute nahebringen und als geistigen Nährwert schmackhaft machen, ihnen, die sich, wie sie mittlerweile früh gemerkt haben, mit einigem Erfolg durchs Leben schlängeln wollen in der horizontalen, die sich auf den tückischen Umgang verstehen lernen müssen mit allem, was instabil ist, fliesst und sich im zunehmenden Accelerando der Modeschübe verändert in einer Welt, die sich – ja, warum nicht sagen: lüstern – anbietet als Oberfläche ohne metaphysische Tiefe dahinter, darunter, ohne Höhe darüber: als Welt zum Gleiten, Rutschen, Rollen, Surfen. Nicht anders als die global rund um die Uhr flimmernden Fenster der Monitore – für sexy, hört man, halten sie viele, diese haut –, ohne Dahinter, ohne Davor und ohne dass, ungemütlicherweise, die Software dabei ihr Inneres und die Hardware ihr körperlich bewohnbares äusseres wäre. Wie es traditionellerweise im Verhältnis Körper-Seele oder Körper-Geist gedacht wird. Da verfängt der schwarz-weisse Holzschnitt binärer Schematismen längst nicht mehr: Gott oder Welt, Himmel oder Hölle, gut oder böse. Damit lassen sich zwar heilige Kriege auch heute noch bös rechtfertigen. Moralische Legitimationen für die ausschliessende Eingrenzung von angeblich Eigenem gegenüber scheinbar Fremdem scheinheilig finanzieren. Wenn’s sein muss fundamentalistisch, unter Berufung auf einen Gott allein, auf den «allein» alle Verantwortung menschlichen Handelns, glaubt man solchem Glauben, entlastend übertragen werden kann, weil in ihm «allein» alle Lebenslinien aller sich angeblich schneiden. Zum Beispiel auch: wenn er «allein mein Herze haben» soll oder es gar haben will. «Gott soll allein mein Herze haben»? Wer sagt das? und: kann ich das, wie bei normativen Soll-Sätzen so üblich – auch bereit sein, zu wollen und mitzusprechen mit einer inneren Stimme ? Wer das beherzigt, scheint es, hätte dann kein Herz mehr zu verschenken oder zu verlieren. Woran, an wen auch immer. Ans Mitgeschöpf. Eine Blume, ein Tier. An den Nächsten, den Fernsten auch. An sogenannte Tote oder an Angehörige noch ungeborener Generationen. An die Folgen meiner Handlungen. An Ideale also.
So fing ich an zu fragen. Und hatte dabei noch gar nicht angefangen nachzudenken. Geschweige denn, vorurteilslos, in den Text, mithilfe der Musik, hineinzuhören.
«Gott soll allein mein Herze haben»: Weiter kann sich ein Herz – Ort und Medium des sich hier aussprechenden, aussingenden Erlebens – nicht öffnen als in solcher Gebärde totaler Hingabe, rückhaltloser, bedingungsloser, ausschliesslicher Zuwendung. Nicht freilich zu einem direkt angesprochenen, ansprechbaren Du, das sich liebend umarmen, als Gegenüber benennen, rational erfassen und erreichen liesse. So hyperbolisch, so sehr über alles Einzelne hinausfliegend, was ausser und neben «Gott» auch noch liebenswert sein könnte, ist diese hier geforderte Bereitschaft zu lieben, dass sie aufs Ganze geht, ganz nur Gott «allein» gilt und somit «Gott» als dem einzigen Ganzen, von dem alles andere ebenso ausgeschlossen ist wie es, als sein Teil, in ihm enthalten ist. Das ist, paradoxal, die logische Folge solcher Gottesliebe. Aber es ist ja auch bei der Menschenliebe nicht anders: dass auf dem Gipfel des Liebesaktes die Frage müssig wird, wer wen enthaltend in wem enthalten, wer der nehmende und wer der gebende Teil ist. Indessen: wenn «Gott» alles und ausser «Gott» nichts ist, ist er so sehr ganz und so sehr alles, dass er, wie Kant es in seiner «Kritik der Urteilskraft» vom mathematisch «Erhabenen» sagte, «über jeden Vergleich erhaben» ist, mit nichts zu vergleichen, vergleichbar allein mit nichts. Mit nichts verglichen aber ist alles, noch das Kleinste, plötzlich unendlich gross. Dabei wird dieses Ganze so übervoll alles, dass es sich zugleich zu einem überquellenden Nichts entleert, das wiederum so allumfassend ist, dass seine Fülle überfliesst und sich entleert, und so weiter und so fort.
«Ausser Gott ist alles nichts», lese ich bei Angelus Silesius im «cherubinischen Wandersmann». Bei alledem erscheint mir jedoch am allerwichtigsten dies: Was hier «Gott» heisst, so gelesen, so gehört, teilt – ich kann nicht sagen: seine Struktur, eher sein Bewegungsgesetz – mit dem Herzen, das sich leer macht, um sich mit «Gott allein» zu erfüllen. Es pumpt und es saugt. Gottesliebe, von ganzem Herzen. Lev heisst dieser Herzensgrund auf hebräisch. Wenn aber das Ganze mit dem Namen «Gott», dem die Liebe hier sich ganz und «allein» verschreibt» alles, wer weiss, liebend umfängt und nichts ist ausser ihm, dann gibt es dieses Ganze nicht wie es gibt, was sich innerhalb seiner befindet. Und dieses Ganze wäre am Ende ein anderes Ganzes, ein ganz anderes. Quo maius cogitari non potest. So lautete die Formel des Anselm von Canterbury: worüber hinaus nichts Grösseres hinausgedacht werden kann. Ausser das Denken, muss man hinzufügen, das diesen undenkbaren Gedanken, «Gott», über sich selbst hinaus denkt. Damit bekommt der Satz – «Gott soll allein mein Herze haben» –, nimmt man ihn ernst, – Bach lässt ihn, gegenüber der viermaligen Wiederholung im Text, 18-mal ausschwingend aussingen – eine schwindelerregende Tiefe oder Höhe. Und ist noch längst nicht ganz durchdacht und durchfühlt. Denn: das «Herz», das als das je meinige Gott allein sich geben «soll», bleibt ja, zusammen mit dem Ich, das gleichsam als sein Besitzer spricht, nicht als Beobachter solchen Loslassens davon unberührt zurück, sondern wirft sich, à fonds perdus, ins zu liebende, göttlich Geliebte und lässt sich letztlich von sich selber los, indem es sich, mit einer Wendung Kierkegaards, im Mut zum freien Fall, in den Abgrund Gottes fallen lässt, ohne zu wissen, ob dieser es annimmt oder nicht. Diese Liebe ist so unüberbietbar weit und tief und stark gedacht, dass, wer in ihr wäre, keiner ethischen Gebote und Verbote mehr bedürfte, sondern mit Augustin getrost sagen könnte: «Liebe und tu, was du willst.» Deshalb wohl kann sie’s auch so leicht aufnehmen, diese Gottesliebe, mit den gefährlichen Verlockungen der Welt. Festzuhalten jedenfalls ist dies: «Gott soll allein mein Herze haben» etabliert zunächst einen scheinbar ichlosen Bezug zwischen «Gott» und «Herz» zirkulär so, dass ich, was ich geben will, nur geben kann, weil ich’s vom Nehmenden immer schon zurückbekommen haben werde, und zwar in der Art, wie ich’s gebe. Nämlich liebend. Deshalb ist auch in dem Ausdruck «die Liebe Gottes» – der aufhorchen lässt, weil er an Spinozas «amor Dei» erinnert – der Genitiv doppelt, nach zwei Seiten hin gleichzeitig zu lesen: Die Liebe zu Gott wird dann selber zu einem Geschenk göttlicher Liebe, das Gott sich selber macht als «Liebe Gottes». Von der Liebe, «aus der Gott sich selbst liebt», spricht Spinoza. Entspricht das nicht auch, möchte ich fragen – in welcher Religion und Konfession auch immer – meditativer Versenkung und dem Beten: als Dank, in der Liebe leben und dafür danken zu dürfen, dafür also auch, so zu danken? Dank als Geschenk. Gott sei Dank. Und wenn am Ende, was hier «Gott» genannt wird, nur ein anderer Name für solche Liebe, genauer, weil dynamisch und nicht statisch zu denken, für solches Lieben wäre? Nicht umsonst ist die «Liebe Gottes» am Ende eine «Gunst». Und nicht umsonst schliesst der Schlusschoral mit dem Kyrie eleison, der Bitte um Erbarmen und Gnade. Weil auch das rechte Bitten und Beten, zu dem der Text in seinem Erklingen und in seinem Verklingen sich erhebt, nicht aus eigener Kraft allein gelingen kann. Liebe, die hier zunächst in Bezug auf «Gott» erprobt wird und sich dann später im Text entsprechend auch im Zwischenmenschlichen bewähren muss, Liebe kostet nichts, ist vielmehr ihr eigener Preis, also unverhandelbar und unveräusserlich. Was wir lieben, wird für uns über alle Massen wertvoll, weil wir es lieben. Und auch der geliebte Mensch existiert so nicht, bevor wir ihn nicht, auch uns selbst zutiefst dabei verändernd, liebend so erfinden. Dann ersetzt er, glauben wir, die ganze Welt. Und ist doch gerade ersatzlos unersetzlich. Liebe unterläuft jedes Tauschverhältnis zwischen Geben und Nehmen. Sie ist deshalb vielleicht, wie Stendhal in «De l’amour» so treffend schrieb, die einzige Leidenschaft «qui se paie d’une monnaie qu’elle fabrique elle-même». Dazu kommt die offensichtliche Grundlosigkeit selbstloser Liebe. Bernhard von Clairvaux sagte in einer seiner Predigten über das hohe lied («Sermones super cantica canticorum», 83): «Die Liebe verlangt ausser sich keinen Grund, keine Frucht; ihre Frucht ist ihr Genuss. Ich liebe, weil ich liebe; ich liebe, um zu lieben» (amo quia amo, amo, ut amem). Das lässt sich so vom lieben genauso gut sagen wie vom Leben. Und genau so sagt’s Meister Eckhart in einer seiner deutschen Predigten: «Ich lebe dar umbe, daz ich lebe». Und weiter: «Das kommt daher, weil das Leben aus seinem eigenen Grunde lebt und aus seinem Eigenen quillt; darum lebt es ohne Warum (âne warumbe) eben darin, dass es sich selbst lebt». So brauchen die liebenden, die ja immer auch in höchster Intensität lebende sind, nach keinem Grund zu fragen fürs Leben und fürs Lieben. Sie tragen ihn im Herzen. Grundlos. Abgründig.
Mir scheint, es ist zu hören, dass Bach jenes «Bächlein» bloss irdischer «Zufriedenheit» zu einem singenden, klingenden «Strömen» steigert, das darauf aufmerksam macht, aus welchem «Quell» diese Musik geschöpft ist. Musik, die nicht nur sättigt («sattsam») – der Hunger kommt wieder, je stärker die Sättigung, desto stärker –, sondern «Herz», «Seele», «Geist» auch zu «laben» imstande ist wie Arznei – so liest man im «Grimm’schen Wörterbuch» unter dem Stichwort «laben» –, wenn sie «erloschene Lebensgeister» erquickend «wiederbelebt». «Gott», als «Quell» gesehen und gedacht: Das rührt ans Geheimnis einer Ursprünglichkeit, einer Anfänglichkeit von Lebendigkeit, hinter die nicht zurückgedacht werden kann, sonst wär’s nicht der Anfang und dieser Anfang, ungeworden, nicht ein unaufhörliches, strömendes Anfangen. Zeitlichkeit. Ein Rohstoff, der in Ewigkeit nicht ausgeht. Stoff, aus dem das Leben ist. Und nicht zuletzt besonders auch die Musik. Es quillt, diese Lebendigkeit, aus dem reinen Jetzt, das dabei zu einer Pore der Ewigkeit wird, falls wir es schaffen, es nicht, wie meistens, zu überspringen und zu verpassen, weil wir nach vorne oder nach rückwärts, nostalgisch-elegisch auf Verlorenes fixiert oder in Wünsche verkrallt uns von solcher Geistesgegenwart ablenken lassen. Und der Text qualifiziert sie als göttlich, diese creatio continua, diese überquellende Selbstverschwendung des Lebens. Warum sollte er nicht?
Auch die weltliche Liebe, in diesem Text, ist zweiseitig wie die Gottesliebe. Von ihr ausgehend, zu ihr hingehend. Zur Verführung braucht es zwei: Verführer und Verführbare. Und wenn wir hören «Stirb in mir, / Welt und alle deine Liebe», dann ist Gänsehaut nicht die richtige Empfindungsmetapher. heiss und innig wird die Welt liebend nach innen aufgenommen und gleichsam aufgeschmolzen und umgeschmolzen in dem «Stirb in mir». Und so ist denn auch dieses innige Empfangen und innerliche Absterbenlassen der äusseren Welt mit allen ihren Lüsten und Trieben, anstatt diese abzuwehren und zu verdrängen, ist dieses sanfte Bejahen auch des Verworfenen, all dessen, was in meinem Schatten sich versteckt, eine Übung in der «Liebe Gottes», innerweltlich, durch und durch, und muss, so heisst es, in der «Brust» weiter geübt werden «für und für», weil sich da offenbar nichts mit dem Knopfdruck richtiger Einstellung und proklamierbarer Gesinnung ein für alle Mal regeln, nichts, ohne es immer und immer wieder neu zu bewähren, lösen und erlösen lässt. Die Musik gilt selber schon dieser Einübung, von der der Text nur spricht. Darin liegt denn wohl auch das heilsame herzergreifende dieser Aria. Der rhythmisch-schwebende Herzschlag mit dem im Dreiertakt, immer erst auf den zweiten Schlag einsetzenden orgelbass, ist an dieser elektrisierenden, den gewohnten Boden unter unseren Füssen verrückenden, verflüssigenden Wirkung sicher nicht unbeteiligt. In dieser Absage an die Welt in Liebe ist die anfänglich vertikale «Liebe Gottes» in die horizontale gekippt. Und keineswegs überraschend, sondern von Anfang an vorbereitet erscheint die jähe Zuwendung zum «Nächsten» unter Berufung auf die Schrift. Wobei bei Matthäus nicht zu überhören, Moses mitklingt (5, 6): «Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allem Vermögen. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen.» So übersetzt Luther. Und Zwingli: «Und diese Worte sollen dir ins Herz geschrieben sein». Und Buber-Rosenzweig: «So seien diese Reden…auf deinem Herzen.» Wie denn nun? Als beschwerende last, oder hineingelegt wie etwas, was erst ausgetragen und geboren werden will, oder, als Herzensschrift, leicht, nur drauf geschrieben oder gar – aber dann um welchen Schmerzenspreis? – ins Herz hineingeritzt? Eine Frage für Schriftgelehrte. Die Kantate löst sie, indem sie sie umsetzt in inbrünstigen Gesang, der aus dem Herzen kommt, einem Herzen, das, wenn es erst einmal geübt hat, «Gott» alleine, in ihn hineinsterbend, sich zu schenken, in eben diesem Sinne ebenso gut und ganz, ohne fürs Geben etwas nehmen zu wollen, dem Mitmenschen gehören kann. Das zweite Gebot, sagt Christus im Matthäusevangelium, sei dem «Vornehmsten und Grössten» – der Gottesliebe – «gleich». Diese paradoxe Gleichung hat der Kantatentext schon vollzogen, wenn er’s an dieser Stelle zur bestätigenden Erinnerung noch einmal nachträgt: «Du sollst Gott und den Nächsten lieben».
«Wie dich selbst», muss man, mit Zwingli, ergänzen. Und das ist dann wohl adverbial auf dieses lieben bezogen zu lesen, bei dem die tiefe, ursprüngliche, Selbstliebe zum Massstab wird, an dem ihre Überwindung hin zum Altruismus überhaupt erst messbar wird. «Als dich selbst» übersetzt Luther (hos seauton, im Griechischen). Als würde das «Ich» erst am «Du» erwachen können, als ergäbe sich die Verwandtschaft zwischen dem andern Ich und dem Du, das ich für es, das es für mich wird, erst aus der Aufrichtekraft der besagten Vertikalität dieser Kantate, die sich umgekehrt selber wiederum nur aus der Horizontalität solcher Zwischenmenschlichkeit aufrichten lässt. Das ist, wahrlich, eine weltentrennende Übersetzungsnuance. «Gott und den Nächsten» – dieser mirakulöse Einsilber «und» ist für einmal hier kein Alleskleber, sondern die Vokabel für den Punkt, wo die beiden Achsen des Liebens, die vertikale und die horizontale, bezeichnenderweise in Kreuzform sich schneiden und wo Gottesliebe und Nächstenliebe sich nicht mehr unterscheiden. Dieses «Wo», diese Mitte, wie es Nietzsches Zarathustra, als wäre es ein Zen-Mantram, formuliert, ist überall und, als Bedingung der Lokalisierbarkeit von allem, was im Koordinatensystem des Zeitraumkontinuums auffindbar und lokalisierbar ist, selber nicht mehr lokalisierbar. Aus diesem Drehpunkt und Nullpunkt generiert das Achsenkreuz jene Wir-Kraft, die neu hier mit dem Lutherzitat in den Text wärmend hineinkommt und über sein Ende hinauswirkt: «dass wir uns von Herzen einander lieben / und in Friede auf einem Sinn bleiben». Friede, solchermassen, obwohl nicht von dieser Welt, für diese Welt erhofft, ist nicht garantiert dadurch, dass alle auf einen gemeinsamen Sinn eingeschworen wären, auf eine codifizierbare Ideologie, ein Programm festgelegt würden. Garantiert wäre er erst durch so etwas wie einen Gemeinsinn, einen Sinn für Gemeinsamkeit, im Sinne einer gemeinsamen lebens-Richtung aller, aller je aufeinander zu. Und in solcher Öffnung in der horizontalen, die der Vertikalen, mit welcher der Text beginnt, an seinem Ende entspricht und in seiner Radikalität in nichts nachsteht – wobei im Doppelsinn von «Sinn» nicht nur der Gegensatz zwischen Ziel und Weg ausgehebelt, sondern auch die klaffende Schere zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit durch das herausdrehen des Schräubchens, um das sie dreht, in einem einzigen Wort dreht, unbrauchbar wird: Sinn – in solcher Öffnung könnte jeder seinen Eigen-Sinn ausleben im Respekt vor dem des andern. In friedlichem polyphonen Zusammenspielen differenter singulärer Individualitäten. Es wäre die Utopie eines sozialen Chorals. Mag das alles aus tiefer Vergangenheit heraufklingen zu uns. Es bleibt unverwelkt gültig für die Zukunft. Mir scheint auch, als könnte man diese hoffnungstrahlen aus Bachs Musik am Ende heraushören. Buchstäblich: heraus. Denn dieses Licht aus Herzensgrund ist so wenig hineinkomponiert wie jenes Licht, das Rembrandt aus den Händen des Vaters herausstrahlen lässt, der seinen verlorenen, zurückgekehrten, sich kniend ihm zugewandten Sohn umfängt. Das Bild hängt in der Ermitage in St. Petersburg, oben, neben einer Tür. ohne es zu sehen, unbeschenkt von dieser Herzenshelligkeit kommt dort niemand heraus. Wie aus dieser Kirche nicht, wer Ohren hat zu hören, was jetzt gleich noch einmal zu hören sein wird.
Und hier und jetzt, an ihrem Ende, wünsche ich mir nichts dringlicher, als dass sie, über sich hinaus, in Musik hinübergehen und darin erlöschen darf, meine kleine Rede – über Gott und die Welt und was dazwischen kommt und beide im Innersten zusammenhält: Liebe.